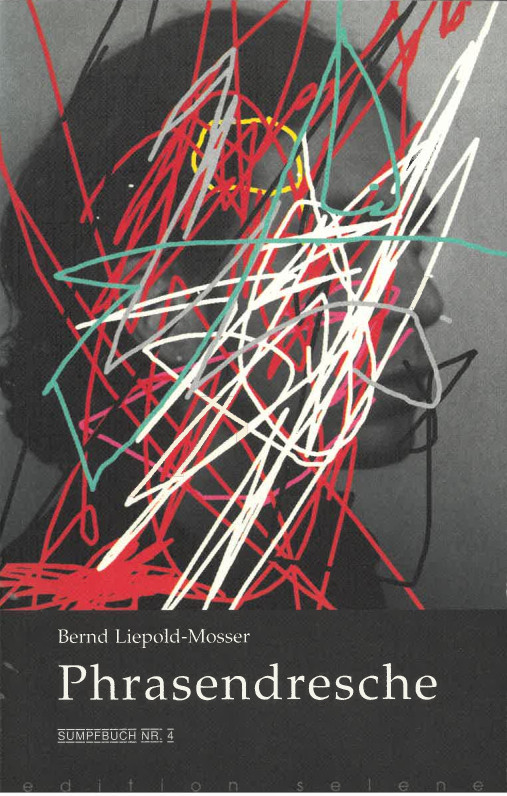Liepold-Mosser geht das Wagnis ein, eine eigene Poetik schaffen zu wollen, eine „Poetik als Text“ und einen „Beitrag zur Phraseographie“. Das sind zunächst zwei unterschiedliche Vorhaben, die eine philosophisch begründete Sprachkritik als gemeinsame Ausgangsbasis haben. Das Schreiben einer eigenen Poetik, einer Theorie der Dichtkunst, steht in einer langen Tradition, die ihren Anfang bei Aristoteles nimmt. Daß Liepold-Mosser seine Vorgänger auf diesem Gebiet kennt und er um den literaturhistorischen und -wissenschaftlichen Umfang weiß, macht der dem Text vorangestellte Auszug aus Martin Opitz‘ Poetik deutlich. Opitz empfiehlt, eine große Anzahl an Büchern zu erkunden, um zu einem eigenen theoretischen Ansatz zu kommen. Quellen der Inspiration, aus denen der Autor schöpft, werden denn auch im Anhang genannt (von Lacan über Derrida bis zu Julian Barnes und dem Musikkritiker Diederichsen). Insofern ist das vorliegende Werk auch eine Absage an einen einzigen, quasi-geniehaften Autor eines Textes, ein vielmehr praktiziertes postmodernes Verständnis von „Autor“. Dieses künstlerische Auswahlverfahren (im übrigen keineswegs eine Erfindung der letzten Jahrzehnte) läßt sich auch mit einem Begriff aus der Musik beschreiben: dem Sampling.
Der „Essay“, der sich als „experimentelles Verfahren“ versteht, besteht aus Reflexionen, die meist als „Phrase“ oder „Motto“ überschrieben sind. In diesen werden sprachliche Erstarrungen aufgezeigt und hinterfragt, wenn Redewendungen in einen neuen Kontext gesetzt oder mit abweichenden Wörtern kombiniert werden („die Wörter wie die Bäume abschlagen wie das Wasser abholzen wie die Bitte abdrehen wie das Zelt abweisen wie den Kopf aufbauen wie den Ball senken“. So treten die Bilder, die die Grundlage von Phraseologien bilden, wieder hervor. Gern treibt der Autor auch das Spiel mit Homophonie (Sinnmus / Sinn-muß). Sprache wird so zum Stein und zum Anstoß gleichzeitig: Subjekt und Objekt der Kritik.