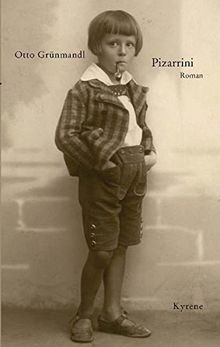Warum es zu Lebzeiten des Autors zu keiner Veröffentlichung gekommen sein mag? Meine Spekulation ist, dass einer, der sein Publikum und sein Auskommen hat, sich bescheidener Honorare wegen nicht dem Druck des Literaturmarktes aussetzen will. So einer nimmt sich das Recht zu schreiben wider die Regel. Das kann ästhetisch zum Absturz führen, hier ist ein vergnüglicher, niemals schwer lesbarer, dennoch gedanklich anregender Text zustande gekommen. Möglicherweise wird „Pizzarrini“ keine Lawine an Diplomarbeiten auslösen, aber etlichen LeserInnen einige vergnügliche Stunden Unterhaltung schenken. Wer ab und zu einen Krimi liest, wird mit Pizzarrini mindestens gleiche Freude haben.
Kommt ein Erzähler vom Kabarett her, dürfen wir eine genaue, pointierte Sprache erwarten, den Genuss beschert hier die treffsichere Beobachtung. Die Schwierigkeit für den Virtuosen des Details besteht meist in der Konstruktion der Geschichte. Diese Hürde wird jedoch vom Autor ohne Verlust an sprachlicher Konkretion gemeistert.
Eine Rahmenhandlung – der tolle Tag einer entgleisten Bürokratenseele – enthält die Binnengeschichte eines Wirtschaftsunternehmens.
Grünmandls unbekümmerter Erzähler der Rahmengeschichte erzählt von der Begegnung der Titelfigur mit einem Erzähler, der seine Geschichte in die Rahmenhandlung hineinschachtelt und bald in den Vordergrund schiebt. Auffällig und verwirrend: die Erzähler gleichen einander, als wären sie eine Person. Gut vorstellbar ist der Text gesprochen auf der Bühne von einem Schauspieler: da könnten die Figuren durch Variation von Stimme und Sprechweise deutlich genug unterschieden werden. Im Lesetext ist dies nicht so einfach. Die Rahmenhandlung interagiert schließlich mit einer dritten Geschichte und verschmilzt mit der Binnenerzählung.
Diese verschiedenen Schichten stehen auch für verschiedene wirtschaftliche Sphären: Pizzarini ist respektierter Alleinbuchhalter eines konkurrenzkapitalistischen Textilkaufmanns. Seine Überheblichkeit in Verbindung mit seiner sexuellen Impotenz machen ihn anfällig für die betrügerische Phantasie des zweiten Erzählers Podesta, Verkörperung der monopolistischen Wirtschaft, die nur durch Manipulation der Käufer noch wachsen kann. Podesta hat letztendlich nichts anderes im Sinn, als Pizzarrini um seine Ersparnisse zu bringen – was ihm auch gelingt. Der Betrüger präsentiert sich und seinen Kompagnon als Präsidenten bzw. Ingenieur einer großen Speisewagengesellschaft. Er malt ihm eine glanzvolle Welt aus, mit prunkvollen Bürogebäuden und schnellen Dienstautos, deren Oberbuchhalter Pizzarrini werden soll. Der Betrug gelingt, Pizzarrini träumt sich in seine mächtige neue Stellung und wird am Ende die Zeche zahlen.
In den 70er Jahren setzte man sich mit der Frage „Reklame oder Werbung?“ in moralisierenden Kolumnen und in kritischen Schulaufsätzen häufig auseinander. Das Thema markierte den Übergang zur Sättigung, zum Überfluss der entwickelten Industriegesellschaften, deren Käufer durch Manipulation, nicht durch Überzeugung oder Information, zum Öffnen der Geldtaschen getrieben werden. Im Roman stehen sich die Welten gegenüber: das alte System des Wettbewerbs und der Versorgung nach Bedarf (der Textileinzelhändler, der ökonomisch Grenzen setzt, wenn er z. B. dem Leichenbestatter keine Verzugszinsen berechnen will, obwohl das Schema der Mahnbuchhaltung es verlangt) und das neue, in dem große monopolistische Unternehmen Bedarf erzeugen (Präsident Schmidbruchs Speisewagengesellschaft, die zur Manipulation greift, um sinkende Umsätze zu kompensieren). Grünmandl hat dafür ein originelles Symbol gefunden: Die Fressmarionetten der Speisewägen sind lebensechte Computer in Menschengestalt, die Appetit vorspielen, um die übersättigten und konsumunlustigen Mitfahrenden zur Bestellung anzuregen. Das wirkt, doch weil die Fressmarionetten Appetit nur zu Verkaufszwecken erzeugen, erzeugen sie ihn auch dort, wo er schädlich ist: bei einem Kranken, der Diät halten müsste. Motor dieses Systems ist der Präsident der internationalen Speisewagenfirma, der auf diese Weise seine Umsätze retten will, als Helfer fungiert der geniale Techniker, der an nichts anderem interessiert ist als am Geldverdienen, als Verwalter schließlich der leidenschaftslose Buchhaltertyp Pizzarrini, dem die Regeln der Doppik über alles gehen. Grünmandl zeigt damit das Panoptikum der neoliberalen Akteure, die behaupten, dass die Verfolgung des Eigennutzes letztendlich dem Gemeinwohl diene. Nicht zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Romans, der einige Zeit zurückliegen dürfte, sondern heute, im Nahkontakt mit der Katastrophe, ist sichtbar, dass nicht nur die Umsetzung der kollektivistischen Theorie am menschlichen Wesen scheitert, sondern auch die der individualistischen. Die Ursache der Appetitlosigkeit kann das einzelne Unternehmen nicht beseitigen, so greift es zur Manipulation, um das Geschäft erhalten. Die Fressmarionetten betrügen die Konsumenten ebenso wie die anderen manipulativen Techniken, die angewandt werden, um zu sinnlosen oder schädlichen Käufen zu veranlassen.
Für den Buchhalter Pizzarrini geht der Wahn schließlich günstig aus: er verliert zwar sein Geld, aber ist um eine wesentliche Erfahrung reicher. Am Ende ist er nach durchstandenem Abenteuer mit den Betrügern zu einer freundlichen Hinwendung zu einem Mitmenschen – einem Kind – fähig. Damit gibt dieser recht vergnüglich zu lesende kleine Roman einen optimistischen Ausblick.