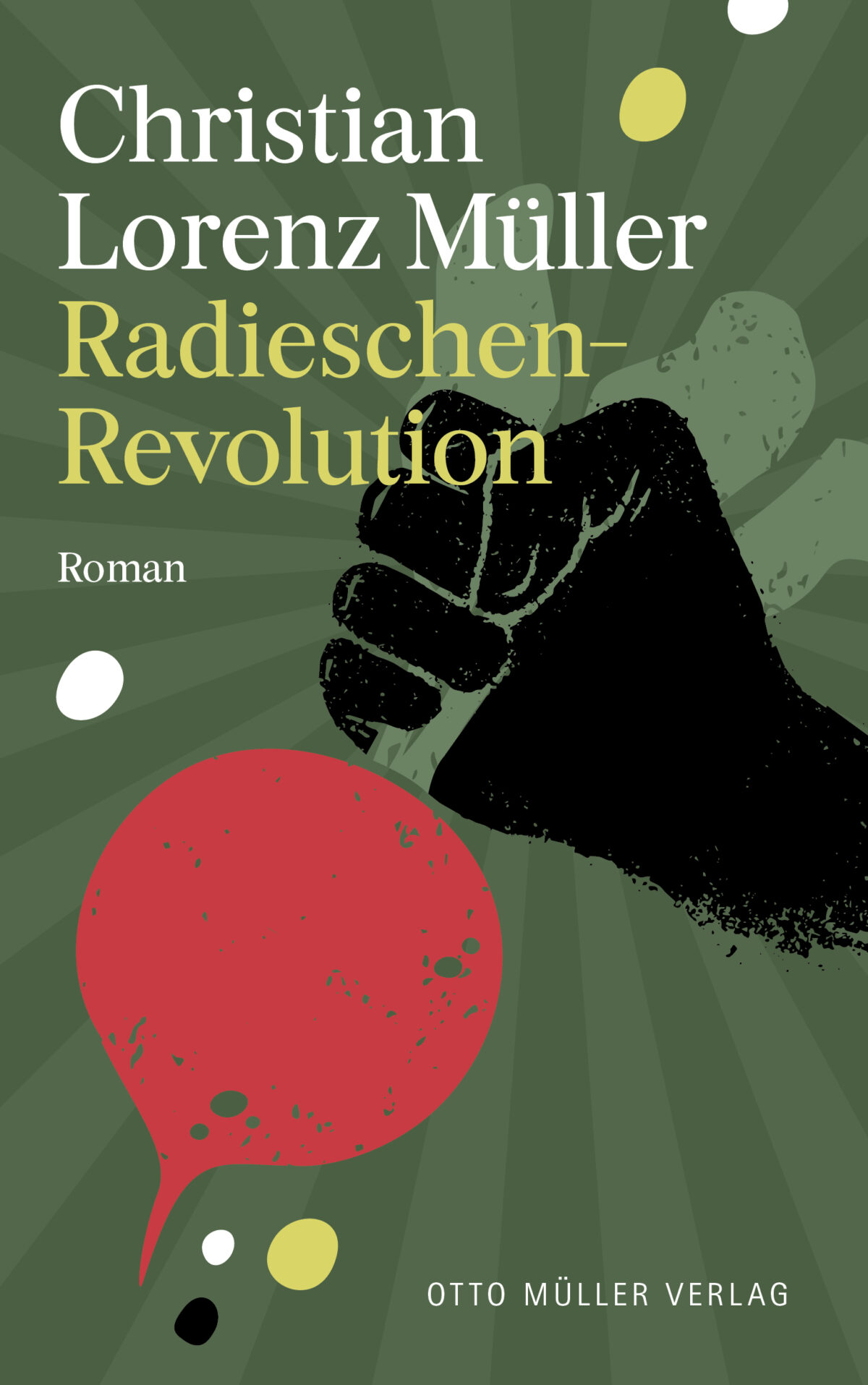Gerd und Elfi heißen die Protagonist:innen der anzuzettelnden Revolution, die sich schon bald nach deren Einstieg in einen städtischen Quartiersgarten ankündigt. Die Idee, diesem beizutreten, kam eigentlich von Elfi. Und schneller als gedacht, springt auch bei Gerd der Funke über. Beide in der Kulturszene aktiv – er als Rezensent, sie als Regieassistentin – sehen sie sich bald durch die Gartenarbeit wohltuend geerdet.
Beim Garten-Opening im Frühling lernen wir die im Weiteren handelnden Personen schon einmal kennen: die sonnige Doris und die resche Alex, den Biertrinker Helmut und den älteren Profigärtner Petrus, der sich ein wenig nach Gerds Opa anfühlt. Oberflächlich besehen kommt Elfi zu dem Schluss: „Alle hier sind nett!“ (S. 20) Im Nu übernimmt der Rezensent die Arbeit an ihrem Beet, da sie selbst gerade mit der aktuellen Theaterproduktion überlastet ist. Das Rezensieren gerät bei Gerd angesichts der Erkenntnis, im Garten vollkommen richtig zu sein, in den Hintergrund. „Ich habe mich getäuscht! Die Poesie ist nicht in den Romanen, in den Gedichtbänden, stattdessen flittert sie in Hunderten von Insektenflügeln über ein Gemüsebeet;“ (S. 83)
Eine plötzliche Wendung der Idylle tritt ein, als sich das mit Elfi befreundete Schauspieler-Liebespaar Jan und Ines zeitweilig in der Gartenhütte einnistet, was vom Gartenvorstand keineswegs goutiert wird. Gerd und Elfi lehnen sich gegen die ihrer Meinung nach zu autoritären Regeln auf und werden letztendlich zusammen mit den Liebenden des Gartens verwiesen. Doch nun wird Gerd erst richtig aktiv. Zusammen mit denen, die sich solidarisch erklären, nimmt er ein eigenes neues Projekt in Angriff und erfindet mit Hilfe von Elfi das „Gartenradieschen“ – einen Gemeinschaftsgarten mit einem Grundriss in Radieschenform. Doch es dauert nicht lang und auch dieser Traum der friedlichen Koexistenz im kleinen Ökoparadies droht zu zerplatzen.
Wie man so liest, sind es vor allem die vielen kontroversen Nichtigkeiten, die ein funktionierendes Gemeinschaftsleben so anstrengend machen. Statt gemeinsam an einem Strang zu ziehen, reiben sich die Gärtner:innen in kleinlichen Streitereien auf. Grund dafür ist die unterschiedliche Zielsetzung: die einen wollen möglichst schnell ihr eigenes Gemüse am Teller sehen, andere sitzen am liebsten entspannt mit einer Flasche Bier im Baumschatten, wieder andere suchen den naturnahen Auslauf für ihre Kleinen. Es wird geplaudert und gepflanzt, gegossen und gespielt, aber auch kräftig gestritten, wer wofür zuständig ist, wann Sperrstunde im Garten ist, wo es für die Kinder gefährlich wird oder was aus der Vereinskassa bezahlt werden muss. Die Liste der Streitgründe scheint endlos, was Gerd dazu anregt, darüber nachzudenken, wie das Projekt „demokratischer, freier, partizipativer“ (S. 90) zu gestalten wäre. Das richtige Maß zwischen „Verpflichtung und Freiheit“ (S. 90) zu finden, darum ginge es vor allem, um die soziale Utopie Wirklichkeit werden zu lassen.
Den politischen Anspruch und das zähe Ringen seines Protagonisten um das Potenzial des Gartenprojekts lockert Christian Lorenz Müller mit unterhaltsamen Episoden aus Gerds Rezensenten- oder Elfis Off-Theater-Alltag auf. Die wechselnde Erzählperspektive wirkt belebend: Passend zu Elfis Temperament lässt der Autor sie in Ichform über Gefühle, Meinungen und erotische Sehnsüchte frei von der Leber weg plaudern. Die Sicht auf Gerd dagegen ist auktorial erzählt und zeigt seine Entwicklung vom durchsetzungsschwachen Grübler zum lautstarken Revolutionär. Dabei macht die Tonlage die Musik, und die klingt nicht etwa bierernst sondern bodenständig-humorig.
Christian Lorenz Müller bleibt auf seiner Schneckensuche jedenfalls immer am Boden der Realität – ganz wie es sich für einen Gärtner gehört. Artenvielfalt und biologischer Anbau bleiben bei ihm keine leeren Worthülsen. Die Botschaft, dass jede:r von uns einen kleinen aber wichtigen Baustein zur Festigung eines ausgewogenen Ökosystems beitragen kann, kommt an. Der kollektive Nutzen muss erst erlernt und verinnerlicht werden, den etwa junge Eltern in die nächste Generation weitertragen. Und nicht zuletzt bieten sie damit ihren Kindern einen Gegenpol zur digital überfrachteten Welt. Denn: „Wo erfuhr heutzutage ein Kind das Winkelige, Ungerade, Ungepflegte, das Abseitige und Nutzlose, den Schrott, der zwischen Brennnesseln rostete? Wo, wenn nicht in den stillen Ecken und Enden, begriff das Kind etwas vom poetischen Wesen der Dinge?“ (S. 21)