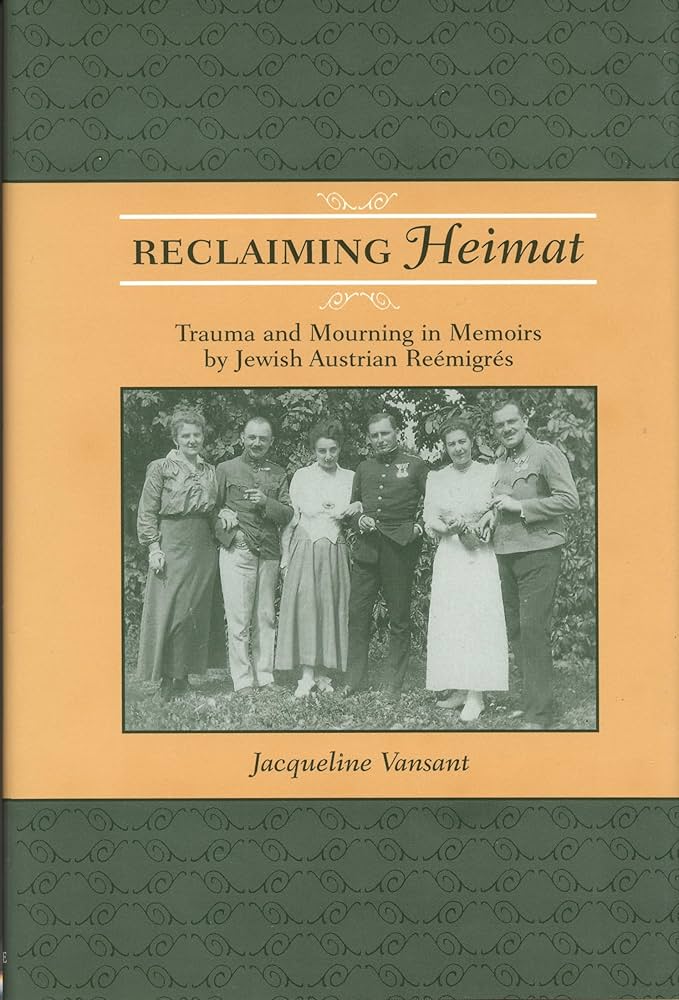Die Autorinnen und Autoren aus assimlierten bürgerlichen Familien, politisch liberal oder sozialdemokratisch orientiert, hatten sich bis zum „Anschluß“ 1938 zuerst als „österreichisch“ und, wenn überhaupt, in zweiter Instanz als „jüdisch“ definiert. Die Nürnberger Gesetze verordneten ihnen jedoch eine einzige Gruppenzugehörigkeit: „Jude“ zu sein, und sie wird in den Berichten als individuell oder kollektiv erlebte Erfahrung von Rechtlosigkeit, Vertreibung, Lebensbedrohung und Verlust evident. Doch nicht darauf legt Jacqueline Vansant ihren Akzent, sondern auf die Versuche der Autorinnen und Autoren, im Spannungsfeld der Zugehörigkeit zu einem realen oder imaginierten jüdischen „Wir“ nach 1945 schreibend an ein österreichisches „Wir“ anzuknüpfen.
Jacqueline Vansant konzentriert sich auf die, wie Raul Hilberg sie nannte, „unerbetene Erinnerung“: mit welchen Verfahren die Zurückgekehrten eine Sprache für ihre Geschichte zu finden suchen, während die österreichische Nachkriegsgesellschaft die wahren Opfer des NS-Regimes zum Schweigen bringen will. Sie beschränkt sich nicht darauf, autobiografisches Schreiben dieses Kontextes als selbsttherapeutischen Akt oder historisches Zeugnis zu beschreiben, sondern sie versucht Parameter geltend zu machen, mit denen die Texte als „mainstream victim narratives“ (31) interpretiert werden können.
Das kleine Korpus neun autobiografischer Texte von sieben Autorinnen und Autoren wird genau begründet, nicht aufgenommene Memoiren im Sinn einer Gesamtdarstellung der Materialgrundlage ausführlich kommentiert. Für die nichtösterreichische Zielgruppe des Buchs skizziert die Autorin den zeitgeschichtlichen und kulturpolitischen background des Landes genauer. Das erste Kapitel bietet auch einen Überblick über die mittlerweile unübersehbar gewordene Literatur zu Holocaust und Erinnerungskultur.
Für die Textauswahl waren biografische Kriterien maßgeblich: Die Verfasser, unter ihnen programmatisch keine Überlebenden von Lagern, erlebten den „Anschluß“ als Erwachsene, alle Memoiren berichten über Kindheit und Jugend in Österreich (bzw. der k.u.k. Monarchie), Flucht, Exil und Rückkehr nach Österreich. Die Autorinnen und Autoren sind: Ernst Lothar mit „Das Wunder des Überlebens“ (1960); Stella Klein-Löw mit „Erinnerungen“ (1980); Hans J. Thalberg mit „Von der Kunst, Österreicher zu sein“ (1984); Minna Lachs mit „Warum schaust du zurück“ (1986) und „Zwischen zwei Welten“ (1992); Franziska Tausigmit „Shanghai Passage“ (1987); Hilde Spiel mit „Die hellen und die finsteren Zeiten“ (1989) und „Welche Welt ist meine Welt?“ (1990) und Elisabeth Freundlich mit ihren Erinnerungen „Die fahrenden Jahre“ (1999). Die 40jährige Spanne zwischen den Erscheinungsjahren reflektiert Jacqueline Vansant von Seiten der Rezipienten, bei denen sich spätestens seit dem „Bedenkjahr“ 1988 ein kritischer Umdenkprozeß im Bezug auf „Vergangenheitsbewältigung“ vollzogen hat. Was der Entstehungszeitraum für das autobiografische Schreiben und die literarischen Verfahren selbst bedeutet, wird an dieser Stelle nicht weiter entwickelt. Abgesehen davon, daß Autoren wie Stella Klein-Löw oder Hans Thalberg in- und außerhalb Österreichs kaum bekannt sind, ist nur Elisabeth Freundlichs Buch („The Traveling Years“, 2001) auf englisch greifbar. Umso größer Vansants Verdienst, die die Autoren in ausführlichen Zitaten selbst zu Wort kommen läßt und den Originaltexten routinierte Übersetzungen beigibt.
Jean Améry verbürgt sich mit seinem Essay „Wieviel Heimat braucht der Mensch?“ (1966) dafür, daß man über Heimat im Zusammenhang mit Exil und Verfolgung nicht als einen emotionsbeladenen, verblassenden Wert sprechen kann, eine „unstatthafte Gefühlssteigerung, die einen aus der Überlegungssphäre hinaus ins Sentimentalische reißen würde“. Seine Überlegungen zu Muttersprache und Vaterland geben auch das konzeptuelle framing der vorliegenden Studie vor. Améry stellt sowohl die Verbindung von Heimat und Topografie her (er nennt sie „Vaterland“ im Sinn eines „selbständigen, eine unabhängige staatliche Einheit darstellenden Sozialkörpers“) als auch den Zusammenhang von Heimat und Erinnerung. Amérys Kategorien von sozialer Beheimatung (sprachlich, räumlich, zeitlich) bilden auch die Basis von Vansants Analyse.
Kapitel 2, „Asserting Narrative Authority“, beschreibt das Dilemma der österreichischen Autobiografen, sich erzählend gegen die übermächtigen offiziösen Sprachregelungen zu Nationalsozialismus und Holocaust zu behaupten, und die Schwierigkeit, das Trauma des persönlichen und kollektiven Verlusts überhaupt in Worte zu fassen. Dies geschieht formal durch Dokumentarisierung ihrer Erinnerung, etwa durch „authentische“ Versatzstücke wie Fotos, Briefe, Tagebücher und, emotionale Effekte vermeidend, durch Ent-Individualisierung des Erzählten: „They reconstitute themselves as ’speaking‘ subjects whose identity is based on the suffering of others as well as their own experiences and memories“ (80).
In Kapitel 3, „Mapping Trauma and Mourning“, zeigt Jacqueline Vansant, wie das Trauma der Vertreibung und des Verlusts in Körpererinnerungen und Krankheitsbilder (Phantomschmerzen, Schizophrenie) bzw. in topografische Metaphern umgesetzt wird. Auch in der Schilderung wiedergewonnener Erinnerungsorte wird die peinigende Trauerarbeit, die die Rückkehr den Autobiografen abfordert, evident.
Im 4. Kapitel, „Reclaiming the Past“, arbeitet Jacqueline Vansant am direktesten die Identifikation der Memoirenschreiber mit ihrem Österreich und mit ihrem Judentum heraus, indem sie, illustriert mit vielen Familienfotos, deren Versuche beschreibt, to „use the past as a tool to root themselves in Austrian society and determine for themselves the meaning of a Jewish identity“. (114) Ob in den Texten auf Familien-, Kultur- oder politische Traditionen rekurriert wird, immer spricht die kollektive Erinnerung von Verlust.
Jacqueline Vansant geht es nicht um den „transitorischen“ Wert dieser Erinnerungstexte als Quellen, sondern um erzählte Erfahrung. Sie stellt die Erinnerungen von österreichischen Remigranten in Gegenrede zur staatlich sanktionierten, an den Tätern orientierten österreichischen Opfermythologie nach 1945 und versucht, die Vielstimmigkeit ihres Sprechens auf einen Nenner zu bringen: „mainstream victim narratives“. Jan Philipp Reemtsma hat Texte wie die hier verhandelten jüngst „Opfermemoiren“ genannt, und seine Perspektive gilt auch für Vansants Auswahl: „Der Bericht aus diesen Bereichen ermöglicht dem Leser aber, jenen veränderten Blick auf die gesamte Welt zu tun, den derjenige tut, der im Buch Zeugnis ablegt.“ (Wenn wir von Schande reden …, in: Die Presse, Wien, 24/25. 8. 2002, Beilage S. 1f.)