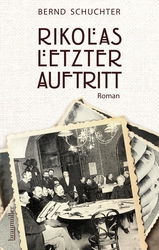So erging es Richard Kola, 1872 in Wien geboren, 1939 ebendort verstorben. Mit internationalen Bankgeschäften groß geworden und mit dem nicht immer ganz sauber arbeitenden Geschäftsmann und Luftfahrtpionier Camillo Castiglioni aufs Engste geschäftlich verbunden, war er ein Quereinsteiger in die Verlagswelt, dem man das Mäzenatentum nicht abnehmen wollte. Sein an der Börse verdientes Geld investierte er unter anderen in Papiermühlen und Druckereien. Da war es naheliegend, das Geschäft nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches mit einem Buchverlag als Aktiengesellschaft anzukurbeln, zumal sich Richard Kola selber nicht nur als Journalist, sondern auch als Buchautor versucht hatte.
Doch Kola war eine Spur zu größenwahnsinnig, zu wenig distinguiert. Ausgerechnet in der Zeit der schweren Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg will er den größten deutschsprachigen Verlag aufbauen. Das bis heute existierende Manko der österreichischen Literaturszene, zwar über einige der besten deutschsprachigen Autoren zu verfügen, aber keinen wirklich ganz großen Verlag im Lande zu haben, will der Quereinsteiger Richard Kola mit neuen Vertriebsideen aufheben.
Was ihm dazu fehlt, sind Mitarbeiter, die Leidenschaft haben, und die Akzeptanz des Buchhandels und der Autoren. Diese werfen ihm die billigen Ausgaben von Klassikern ebenso vor wie die Kinowerbung für einen nicht gerade seriös wirkenden „Frauen-Almanach“. Immerhin gelingt Kola der Coup, den neuen Roman von Thomas Mann, ausgerechnet Felix Krull – Bekenntnisse eines Hochstaplers, zu publizieren. Ein Titel, der für das Leben von Richard Kola zu passen scheint.
Tatsächlich erfährt man in Bernd Schuchters Buch relativ wenig Persönliches über diesen Aufsteiger, der an windigen Spekulationsgeschichten gescheitert ist. Bis heute ist wenig über Richard Kola bekannt, geblieben sind die teils antisemitischen Vorurteile gegen den Branchenfremdling und die Erinnerung an das spektakuläre Ende eines Verlegers. Denn ausgerechnet während der großen Redoute, einer noch nie gesehenen Werbeveranstaltung in der riesigen Rotunde im Wiener Prater, muss Richard Kola erfahren, dass nicht nur die Inflation sein Vermögen vernichtet hat, sondern auch seine Spekulationen gescheitert sind. Geld für das verlustbringende Verlagsgeschäft bleibt ihm nicht mehr. Der nächste große Coup, ausgerechnet das angekündigte zweite Buch von Adolf Hitler verlegen zu wollen, scheitert auch an politischen Widerständen in Österreich. Zurück bleibt ein Mann, dem man den Aufstieg immer geneidet hat und dessen Fall man genießt. Es bleiben viele Fragen, etwa warum der Literaturbetrieb so konservativ und ablehnend reagiert hat, und wenn man Parallelen zum Heute ziehen will, warum sich so wenig geändert hat.
Schuchter hat mit seinem Buch vor allem das keinesfalls idyllische Bild einer Zeit kurz nach dem Zusammenbruch des Habsburger Reichs vorgelegt: Die Inflation, die Millionen zerrinnen ließ, die Vergnügungssucht der Massen, die Not in den Städten und der Aufstieg und Fall von windigen Spekulanten. Dass man nicht allzu viel über die Persönlichkeit von Kola erfährt, ist sicher der Quellenlage geschuldet, hat sich doch die Wissenschaft bislang nur wenig um Kola und seinen Verlag gekümmert. Trotzdem unnötig erscheinen die Klischees im Roman, wie die sexuelle Beziehung von Kola zu seiner grauen Sekretärin, die ein Doppelleben als Sozialistin führt. Oder die Geschichte des kleinen Botenjungen, den Kola auch dann nicht hängen lässt, als er selber bankrott ist. Doch das sind verzeihbare Schwächen, denn sie treiben die Geschichte zu ihrem fulminanten Höhepunkt, Rikolas letztem Auftritt als Großverleger bei seiner eigenen Redoute. Schuchter gelingt es mit diesem Buch, ein wichtiges Kapitel der österreichischen Literaturgeschichte wieder öffentlich bekannt zu machen und eine Zeit der rasanten Umbrüche zu porträtieren. Er karikiert aber auch zugleich den Literaturbetrieb und das Sepekulantentum, die sich so wenig geändert haben.