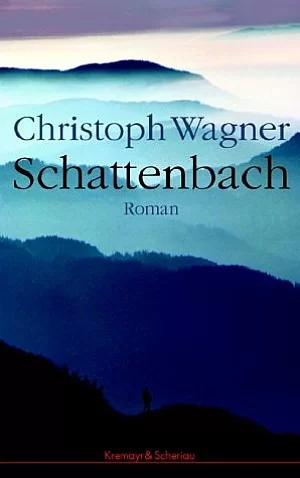Der Ort Schattenbach könnte im Weinviertel liegen, aber auch anderswo in Österreich, und vereinigt in sich und seinen Bewohnern sämtliche Tugenden und Untugenden des Landes; er kann also höchst symbolisch aufgefasst werden. Sowohl was geographische Faktoren angeht, charakteristische physische Gegebenheiten der Kleinstadt, die Population und das Klima, wie auch soziale und ökonomische Strukturen der beschriebenen Gegend, fungiert Wagners Schauplatz in sämtlichen Details als aufschlußreicher Indikator für die Wesensart der Figuren und ihre Taten.
Der Protagonist heißt Mario Carozzi, seines Zeichens ein junger Archäologe, der nach längeren Arbeitsaufenthalten in Mexiko und Ephesos mangels attraktiverer Angebote eine Anstellung als Kustos im kleinen Heimatmuseum von Schattenbach angenommen hat. In einer Ich-Form ohne rhetorische Kniffe (wie etwa bei Wolf Haas) erzählt er nun von seinen dortigen Erlebnissen und Verstrickungen in dunkle Machenschaften – und es kommt wahrlich einiges zusammen! Fast zu viel für einen Einzelnen, dessen innere Distanz und Fremdheit gegenüber den Einheimischen schon im Namen anklingen und der sich durchaus bewusst ist, kein Abenteurer vom Schlage seines Fachkollegen Indiana Jones zu sein. Als nämlich eines Morgens eine berühmte Madonnenstatue, die an einer Hand sechs Finger aufweist, verschwunden ist, kurz darauf ein menschlicher abgeschnittener Finger (wie weiland in Josef Haslingers Opernball) und schließlich eine ermordete Asylantin im Chorgestühl der Kirche gefunden werden, da gerät Carozzi selbst unter Verdacht und es bleibt ihm nichts übrig, als auf eigene Faust Erhebungen anzustellen. Er wird, wie viele Krimihelden vor ihm, zur ‚Spürnase‘ wider Willen und mischt die feine Schattenbacher Gesellschaft kräftig auf.
Die Handlung verläuft, wie es sich gehört, mehrsträngig und entwickelt eine immer dichtere Atmosphäre aus vitalem Hinterwäldlertum, Bigotterie, eingeschworener Missgunst, Bosheit, Tratsch und Klatsch, aber auch aus bodenständiger Gerissenheit, Kunstgeschichte, Volkskunde und, nicht zuletzt, Hinweisen auf kulinarische Feinheiten der lokalen und internationalen Küche. Das meint der Autor, der als Gourmet-Spezialist einen Namen hat, sich (oder bloß einer Mode?) wohl schuldig zu sein.
Das vorgeführte Wertesystem wird einer hochnotpeinlichen Analyse unterzogen, kollektive und individuelle Vorstellungen, was denn unter ‚Normaliät‘ oder ‚Moral‘ über haupt zu verstehen sei, einander gegenübergestellt. Resultat ist ein zynisch eingefärbtes Weltbild; Spannung und Satire gehen Hand in Hand und vermitteln einen Schein von Realität, die ihre Glaubwürdigkeit nicht aus Fakten bezieht, sondern aus einer originellen Verquickung von ‚Setting‘ und Sitten. Manche Ausführungen Christoph Wagners freilich sind derart verkünstelt, dass seine Ironie Kapriolen schlägt und einem das amüsierte Schmunzeln beinahe schon wieder vergällt wird. Hüten sollte er sich in Zukunft unbedingt vor dem adjektivischen Gebrauch von „nämliche“ und – zumindest im Sinne des üblichen kriminalliterarischen fair plays – darauf achten, dass seine Figuren von Anfang bis Ende den gleichen Namen tragen (vgl. „Pettenhofer“ – „Pettenbacher“, S. 168). Vielleicht genügt es aber, einfach den Verlagslektor zu wechseln.