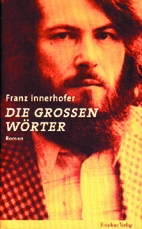Als ungeheuerlich empfand man, daß in Österreichs Provinz bis hinauf in die 60er Jahre Zustände wie die beschriebenen herrschen konnten. Noch dazu, wo man gerade dabei war, solche und ähnliche Landstriche für sich selbst als Feriendomizil zu entdecken. Tröstlich war die Tatsache, daß der Autor mit der Niederschrift seines Buches den Schrecken nunmehr bereits hinter sich gelassen zu haben schien. Das paßte nicht schlecht zur gesellschaftlichen Aufbruchstimmung der frühen 70er Jahre, in der man soziale Durchlässigkeit förderte und pries. Die Gestalt des Schriftstellers paßte obendrein ins Bild. Die großen Hände und die klobige Erscheinung Innerhofers blieben nicht unbemerkt, in zahlreichen Artikeln wurde auf das exotisch anmutende Aussehen hingewiesen. In einem Interview merkte Innerhofer selbst eher verstohlen an, daß seine Hände durch das viele Schreiben nun bereits wieder etwas kleiner geworden sind.
In die deutschsprachige Literatur fuhr Franz Innerhofer mit seinen großen Händen und viel mehr noch mit seinem großen ersten Buch genau so abrupt ein, wie es die Ankunft seiner Hauptfigur am Hof des Vaters war. Schon der erste Satz spricht es an: „Der Pflege einer kinderlosen Frau entrissen, sah Holl sich plötzlich in eine fremde Welt gestellt.“ Die fremde Welt, in die der Bub gestoßen und die vom Autor an einer Stelle ohne Skrupel tatsächlich als ein „Bauern-KZ“ bezeichnet wird, bleibt ihm bis zum Schluß fremd. Brutal wirft sie das sechsjährige Kind nieder und läßt es elf Jahre lang nicht mehr zum Vorschein, geschweige denn zu Worte kommen. Es ist aber nicht allein der Vater, dieser Landpatriarch längst ausgestorben geglaubten Stils, der dem Knaben zusetzt. Die Stiefmutter, die Knechte und Mägde, der Pfarrer, die Lehrer, die Landschaft, die Arbeit auf dem Hof – dies alles wirkt systematisch an der Unterdrückung mit. Schöne Tage ist keine ödipale Abrechnung, sondern ein Gesellschaftsroman, wobei die Analyse der gesellschaftlichen Zustände in ihrer Präzision bis heute besticht:
„Die Dienstboten und Leibeigenen wurden, sobald einer den Kopf aus der finsteren Dachkammer reckte, sofort in die Finsternis zurückgetrieben. Jahraus, jahrein wurden sie um die Kost über die grelle Landschaft gehetzt, wo sie sich tagein, tagaus bis zum Grabrand vorarbeiteten, aufschrien und hineinpurzelten. Mit Brotklumpen und Suppen zog man sie auf, mit Fußtritten trieb man sie an, bis sie nur mehr essen und trinken konnten, mit Gebeten und Predigten knebelte man sie. Es hat Bauernaufstände gegeben, aber keine Aufstände der Dienstboten, obwohl diese mit geringen Abweichungen überall den gleichen Bedingungen ausgesetzt waren. Ein Kasten und das Notwendigste zum Anziehen waren ihre ganze Habe. Die Kinder, die bei den heimlichen Liebschaften auf Strohsäcken und Heustöcken entstanden, wurden von den Bauern sofort wieder zu Dienstboten gemacht. Die Dienstboten wußten um ihr Elend, aber sie hatten keine Worte, keine Sprache, um es auszudrücken, und vor allem keinen Ort, um sich zu versammeln. Alles, was nicht Arbeit war, wurde heimlich gemacht. Man hatte es so eingerichtet, daß die Dienstboten einander nur mit den Augen, mit Anspielungen und mit Handgriffen verständigen konnten. Wenn irgendwo im Freien eine Magd beim Jausnen von einem Knecht das Taschenmesser nahm, konnten die anderen mit Gewißheit annehmen, daß er noch am selben Abend bei ihr im Bett lag.“
Die Details, an denen Innerhofer seine Analysen festmacht, treten so plastisch hervor, daß sie dem Leser bis heute im Gedächtnis haften. Da breitet die Stiefmutter frühmorgens in der Stube vor den versammelten Mägden und Tagwerkerinnen das Leintuch aus, in das Holl wie fast jeden Tag eingenäßt hat; der Bub steht daneben und vergeht vor Scham. Im Winter klebt er mit der Zunge stundenlang an einem Eisengeländer fest und vermag sich erst knapp vor dem Erfrieren zu befreien – später macht Holl daraus eine Art Sport, indem er versucht, möglichst lange in der nunmehr künstlich herbeigeführten Stellung auszuharren. Oder da ist jenes Pferd, das der Bauer dem Bub übergibt und das dieser ein Stück weit führen soll. Dem Vater ist es völlig unverständlich, daß der Bub Angst hat. Mit Ohrfeigen treibt er ihn zu den fliegenden Hufen zurück.
Beim abermaligen Lesen des Buches fällt auf, mit wie wenigen Strichen Innerhofer solche und ähnliche Szenen hinbekommt und wie authentisch sie wirken, gerade weil der Autor (im Unterschied zu den nachfolgenden Büchern) nicht in ich-Form erzählt. Nach der Ankunfts Holls auf dem Hof des Vaters dauert es in „Schöne Tage“ kaum drei Druckseiten, bis der Bub dort ist, wo die Leute ihn haben wollen; auch dies schildert Innerhofer in einem höchst wirkungsvollen Bild: „Einmal wurde Holl vor dem Haus von einem Lastwagen niedergestoßen. Er lag mit Hautabschürfungen auf der Straße, anstatt hervorzukriechen, kroch er noch tiefer unter den Wagen hinein.“
Das Fehlen von Menschen fällt in dieser Umgebung nicht weiter auf. Bemerkt wird es, weil mit den Menschen auch die Handgriffe ausbleiben, die mit ihnen untrennbar verbunden sind und aus denen heraus sich ihre Stellung definiert. Erstaunenswert und für die damaligen literarischen Verhältnisse radikal neu war aber nicht nur die Funktionalisierung des Menschen, sondern auch die Funktionalisierung der Natur, die Innerhofer beschreibt. Anders als in den düsteren Panoramen Hans Leberts oder Thomas Bernhards, in denen die Landschaft anthropologisch aufgeladen und in ihren abseitigen Formen lang und breit beschrieben wird, kommt die Gegend bei Innerhofer nur als ein kleiner Störfaktor neben vielen anderen vor: Vögel „lechzen“ und „grunzen“ und der Blütenstaub „stinkt“. In die Tradition der Anti-Heimat-Literatur, in die Innerhofer gestellt wurde, scheint dies nicht recht zu passen. Kein Wunder auch, wurde doch die Anti-Heimat-Literatur bis dato ausschließlich von Stadtmenschen geschrieben.
Auch wenn der Autor in seinem ersten Roman noch nicht „ich“ sagt, ist es selbstverständlich eine Autobiographie, die er schreibt. Allerdings ist das Konstrukt relativ komplex und geht über den geschilderten Zeitraum hinaus. „Schöne Tage“ endet bekanntlich mit dem Weggang Holls vom Hof des Vaters und der Aufnahme einer Schlosserlehre, die der 17jährige wie eine Befreiung erlebt. Ein ähnliches Gefühl hatte er während seiner langen Knechtschaft nur ein einziges Mal gehabt. Eine Aushilfsköchin hatte am Hof viele kleine Protesthandlungen gesetzt und dem Vater schließlich offen widersprochen. „Holl wäre am liebsten in die Frau gesprungen, um neu aus ihr herausschlüpfen zu können“. Mit dem Weggang vom Hof kehrt Holl an den Punkt antizipierter Freiheit zurück.
Trotz des klaren zeitlichen Einschnitts am Ende nimmt Schöne Tage in gewisser Weise alle weiteren Bücher des Autors vorweg. Im Maß seines Gelingens als literarisches Werk zeigt der Roman, daß aus Holl mittlerweile ein „ganzer“ Schriftsteller geworden ist. Dieser grundlegenden Spannung hinken die nachfolgenden Bücher hinterher. In „Schattseite“ (1975) und „Die großen Wörter“ (1977) wird der Lebensweg vom Lehrling zum Schriftsteller, der im Erstling implizit umgesetzt war, explizit nachgezeichnet, manche Rezipienten zeigten sich angesichts dieser Doppelung verstört.
Nach Meinung der Kritik ging es nach Schöne Tage mit Innerhofers Büchern erst graduell und schließlich abrupt bergab. Die Erzählung „Der Emporkömmling“ (1982) und der Roman „Um die Wette leben“ (1993), in denen sich der Autor mit seiner Existenz als Schriftsteller bzw. mit der Weigerung auseinandersetzt, eine solche Existenz zu führen, wurden kaum mehr mit der nötigen Sorgfalt gelesen. Zu massiv stand damals und steht bis heute das Happy End der „Schönen Tage“ im Raum, nämlich die tröstliche Tatsache, daß man sich allein durch die Kraft des Wortes von einer noch so schlimmen Lebensgeschichte emanzipieren kann. Das Drama von Innerhofers Literatur und – wenn man den Aussagen seiner Bekannten und Freunde traut – auch das Drama von Innerhofers Leben bestand darin, daß man dem Autor nach „Schöne Tage“ einfach nichts mehr geglaubt hat, und zwar gerade deshalb, weil man so sehr an die therapeutische Vision der „Schönen Tage“ glaubte. Der Gedanke, der in dem Erstling steckt und der in ihm zu einem Mythos wurde, ist zwar verführerisch, aber grundlegend falsch. Die eigene Lebensgeschichte gut beschrieben zu haben, bedeutet noch lange nicht, mit ihr fertig geworden zu sein. Genau das hat Innerhofer in seinen späteren Büchern gesagt.
Ein guter Schriftsteller zu sein, heißt für das eigene Leben vorderhand nichts anders, als daß man gute Bücher schreibt. Schöne Tage ist ein solches Buch, gerade auch dort, wo es nicht unmittelbar von Holl handelt. Eines der eindrucksvollsten Porträts ist in dem Roman dem Knecht Moritz gewidmet, der auf dem Hof des Vaters ein Leben der vergebenen Möglichkeiten führt und der von diesem Hof bis zu seinem Tode nicht wegkommt. Moritz sagt nicht viel und wird zu den niedrigsten Arbeiten eingesetzt. In ihm schlummert aber ein ungeahntes Talent. Und zwar ist er ein begnadeter Uhrmacher, der bis spät hinein in die Nacht die kaputten Uhren fast des ganzen Tales in Schuß bringt. Auch neue Uhren kann man bei Moritz bestellen, viele tun es, weil er die Rabatte direkt an seine „Kunden“ weitergibt, ohne für sich auch nur einen Schilling zu nehmen. Aufgrund der zahlreichen Bestellungen wird man beim Großhändler auf Moritz aufmerksam und eines Tages beschließt man gar, den „lieben Geschäftspartner“ zu besuchen. Eine Frau, die im Dorf einen florierenden Uhrmacherladen vermutet hat, taucht nach langer Suche am Hof auf, watet mit ihren Stöckelschuhen durch den Dreck, kann die Situation nicht fassen und verschwindet auf Nimmerwiedersehn.
Der Roman Schöne Tage ist gar nicht so sehr für den Autor selbst, sondern für Leute wie Moritz geschrieben. Auf der vorletzten Seite des Buches wird der Mann zu Grabe getragen: „Der Sarg faßte sich leicht an. Holl ging ein Stück vor dem Bauern im Gleichschritt mit den drei anderen Trägern bachaufwärts und erinnerte sich wieder, daß Moritz sich vorm Sterben stets gefürchtet hatte. Nach mir greifen sie immer noch, dachte Holl, aber mich bringen sie nicht um. Was hat Moritz nicht alles unternommen, um sich zu befreien? Nächtelang saß er über den Uhren, hätte davon leben können, aber diese Bestien haben ihn für unmündig erklärt und sich ihn einfach angeeignet, und alle haben zugeschaut. In den Mund haben sie ihm geschissen. Beichten mußte er und arbeiten. Moritz, du liegst mir leicht auf der Schulter, aber du kannst mich ja nicht mehr hören. […] Irgendwann werde ich diesen Bestien zeigen, daß niemand das Recht hat, andere Menschen zu besitzen.“ Mit dem Roman Schöne Tage hat Franz Innerhofer diesen Schwur eingelöst.