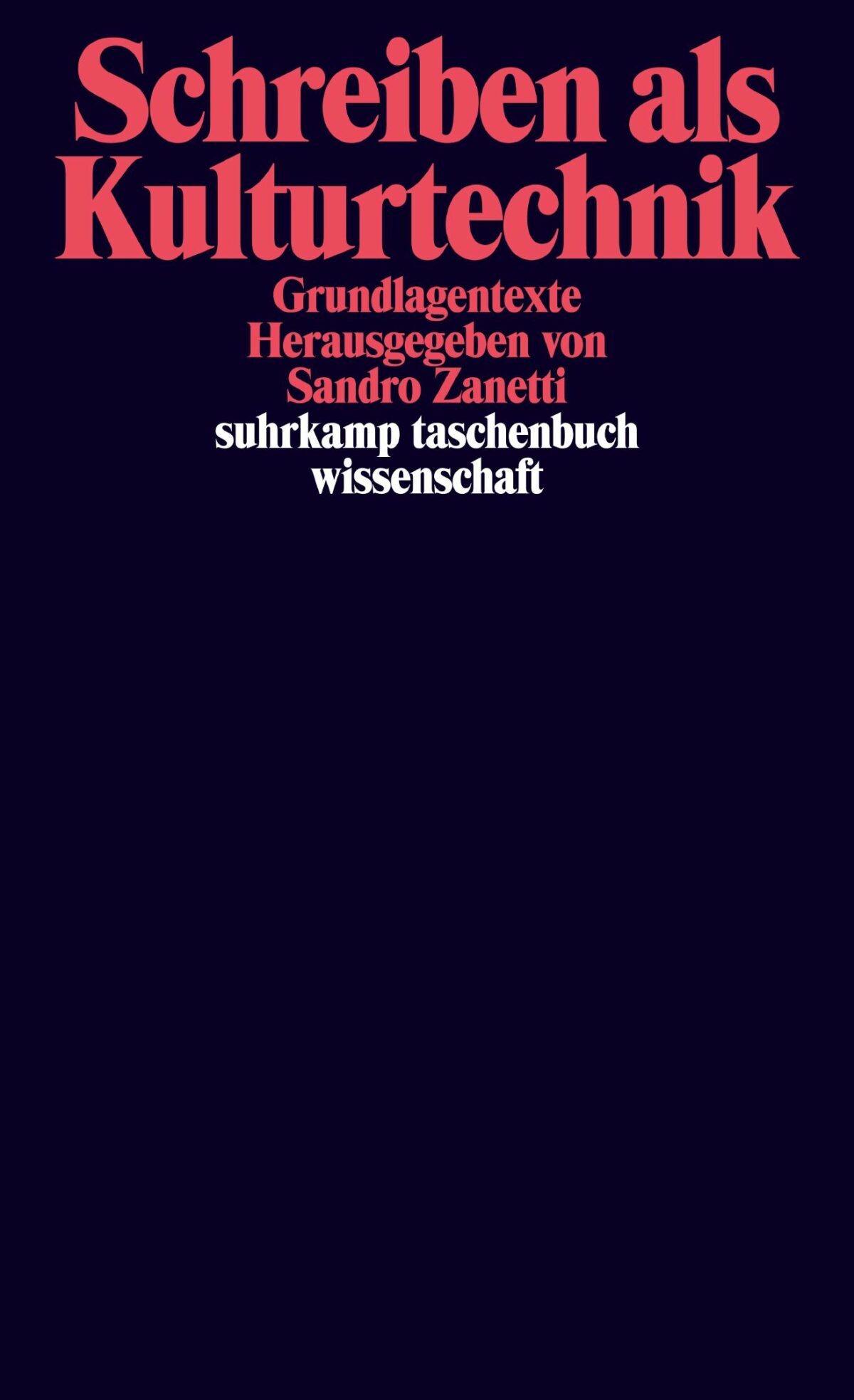Die 20 Texte sind in fünf Gruppen mit je vier Beiträgen geordnet:
(1) Der erste Teil, „Ethno- und historiographische Lektionen“, stellt die Frage nach der kontextuellen Einbettung von Schreibprozessen, also damit auch die Frage nach Machtbeziehungen, und macht „auf die stets spezifischen, aber schnell übersehenen Rahmenbedingungen aufmerksam, in denen Schreibprozesse stattfinden, sei es, indem das Schreiben institutionell angeordnet wird (etwa beim Schreibenlernen in der Schule), sei es, indem das Schreiben selbst Teil einer weitläufigen Demonstration und Artikulation von Macht ist“ (S. 7). Die vier Texte verstehen Schreiben nicht nur als Aussagesystem (etwa als Mitteilung), sondern als Geste, die sowohl Trennlinien zieht wie auch Macht demonstriert (vgl. S. 8). Schreiben ist eine Disziplinierungstechnik und – wie Foucault in seinem Text vor allem zeigt – insbesondere auch eine Selbstdisziplinierungstechnik, die eng mit der Konstitution des Subjekts zu tun hat, also immer in politische und pädagogische Programme eingebunden ist.
Claude Lévi-Strauss: Schreibstunde (1955), Michel Foucault: Über sich selbst schreiben (1983), Heinrich Bosse: „Die Schüler müssen selbst schreiben lernen“ oder Die Einrichtung der Schiefertafel (1985), Friedrich A. Kittler: Die Zeit der anderen Auslegung. Schreiben bei Rilke und in der Kunsterziehungsbewegung (1985).
(2) Der zweite Teil, „Critique génétique und Editionstheorie“, versucht, Schreibprozesse als solche zu klassifizieren und zu kategorisieren, betrachtet Schreiben also stärker aus literaturwissenschaftlicher Sicht, um editionsphilologische Fragen zu klären und den Schreibprozess zu analysieren. „Während die Editionsphilologie danach fragt, wie überlieferte Materialien eines Schreibprozesses am besten zu edieren und also einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind, beschäftigt sich die critique génétique damit, wie man anhand der überlieferten Materialien etwas über den vorangegangenen Schreibprozess erfahren kann.“ (S. 11) Neben den vier hier publizierten Texten wäre in diesem Teil auch ein Beitrag des Innsbrucker Germanisten Hanspeter Ortner von großem Interesse gewesen, der sich in seiner Habilitationsschrift Schreiben und Denken einer Typologie bzw. einem System von „Schreibertypen“ gewidmet hat. Zanetti würdigt diese Schrift jedoch ausdrücklich in einer ausführlichen Fußnote.
Louis Hay: Die dritte Dimension der Literatur. Notizen zu einer critique génétique (1984), Almuth Grésillon: Über die allmähliche Verfertigung von Texten beim Schreiben (1995), Gerhard Neumann: Schreiben und Edieren (1999), Wolfram Groddeck: Textgenese und Schriftverlauf. Editionstheoretische Überlegungen zum Manuskript von Nietzsches Dithyramben-Entwurf „Die Wetterwolke“ (1994).
(3) Der dritte Teil des Bandes, „Körper, Geste Stil: Schreiben im Medium“, fragt nach dem Schreiben als physiologischen Prozess, umfasst also „Beiträge, die sich mit der Interaktion von Körper und Schrift im Vorgang des Schreibens beschäftigen. Schreiben ist ein Vorgang, der notwendig eine Beteiligung des Körpers impliziert“ (S. 16). Hier steht also nicht mehr (wie noch im ersten Teil) die Frage der Einbettung des schreibenden Subjekts in ein kontextuelles Netz sozialer Austauschbeziehungen im Vordergrund, sondern der Modus der Artikulation. „Subjektivität ist demnach auch nichts, was dem Akt des Schreibens bloß vorgelagert wäre, sondern eine Existenzform, die von diesem selbst mit hervorgebracht wird – von Fall zu Fall auf je unterschiedliche Weise.“ (S. 16)
Maurice Blanchot: Das verfolgende Greifen (1953), Roland Barthes: Schreiben, ein intransitives Verb? (1970), Hayden White: Schreiben im Medium (1993), Vilém Flusser: Die Geste des Schreibens (1991).
(4) Im vierten Teil, „Schreibszenen: von der Handschrift zum elektronischen Schreiben“, rückt die Frage des Mediums des Schreibens ins Zentrum, die semiotische, technologische und gestisch-physiologische Aspekte (S. 17) umfasst. Schreiben bedarf spezifischer Instrumente und Werkzeuge, kann also immer nur in einem „Schnittbereich von körperlichen und instrumentellen Aspekten und ihrer Reflexion“ (S. 18) betrachtet werden. Dass sich durch den Medienwandel (von der Handschrift zum Buchdruck zur Schreibmaschine zum Computer zum Internet) das Schreiben entscheidend verändert, ist klar – hier wird diese an sich banale Erkenntnis jedoch ausreichend erläutert und ausdifferenziert.
Rüdiger Campe: Die Schreibszene Schreiben (1991), Martin Stingelin: „Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken“. Die poetologische Reflexion der Schreibwerkzeuge bei Georg Christoph Lichtenberg und Friedrich Nietzsche (1999), Davide Giurato: Maschinen-Schreiben (2005), Jay David Bolter: Das Internet in der Geschichte der Technologien des Schreibens (1997).
(5) Der fünfte und letzte Teil, „Epistemisches Schreiben: erschriebenes Wissen“, fragt nach den epistemischen Funktionen des Schreibens und nach den Unterschieden zwischen schriftlichen und mündlichen Kommunikationsformen. Hier wird auch deutlich – vor allem in den Beiträgen von Jack Goody und Hans-Jörg Rheinberger –, dass Schreiben auch das Verfertigen von Listen (wie sie in den mesopotamischen und altägyptischen Kulturen gebräuchlich waren), Notizen, Protokollen, Tagebüchern oder Laborberichten umfasst. Schreiben ist weit mehr als „nur ein Verfahren der Aufzeichnung“ und als Form der „Erinnerung“, sondern ist eine Form der „Reflexion und Organisation von Information“ (S. 27/28, vgl. auch S. 34), die „sowohl kulturell bedingt als auch kulturkonstituierend ist“ (S. 31). Wie die Wissensbildungsprozesse beim Schreiben aussehen, wird dabei auch zur Sprache gebracht, wobei der Hinweis auf empirische Studien (wie etwa die von Tasos Zembylas und Claudia Dürr: Wissen, Können und literarisches Schreiben. Eine Epistemologie der literarischen Praxis) nicht fehlt.
Jack Goody: Woraus besteht eine Liste? (1977), Carl Bereiter: Entwicklung im Schreiben (1980), Frederic L. Holmes: Wissenschaftliches Schreiben und wissenschaftliches Entdecken (1987), Hans-Jörg Rheinberger: Zettelwirtschaft (2005).
Ganz allgemein sehen die Beiträge dieses Bandes (trotz einflussreicher Gegenstimmen, wie etwa jene von Saussure, Sapir, Hockett oder Bloomfield – vgl. dazu den Beitrag von Jack Goody, S. 341/342) Schreiben nicht als eine Form der (wie auch immer gearteten) Fixierung von Gedanken bzw. der gesprochenen Sprache, sondern als eine Weise des Denkens, deren Modi und performative Konstrukte von jenen des Sprechens deutlich unterscheidbar sind und Denken nicht ‚abbilden‘, sondern strukturieren, konstruieren und dekonstruieren. Jacques Derridas dekonstruktivistische Konzeptualisierung der Schrift (vor allem in seinem Buch Grammatologie) wird zu Recht in der Einleitung mehrmals zur Sprache gebracht, ein Text des Philosophen hätte den schönen Band abgerundet – aber zugegebenermaßen die Ordnung von 5×4 auch durcheinander gebracht.
Dass bei einem so weitreichenden und komplexen Thema das eine oder andere fehlt, ist Zanetti klar: So erwähnt er in der Einleitung etwa das Feld des Kreativen Schreibens und auch Publikationen dazu. Man könnte hier vielleicht auch noch jene Formen der Kommunikation anführen, die in einer gewissen Art und Weise zwischen dem mündlichen und schriftlichen Zeichengebrauch angesiedelt sind: Simsen, Bloggen, Chatten, Twittern, Skypen oder Mailen. Aber von Sandro Zanetti, der als 1974 Geborener bereits ein ausgewiesener Experte der Schreibprozessforschung ist, wird hier sicherlich noch einiges zu erwarten sein.