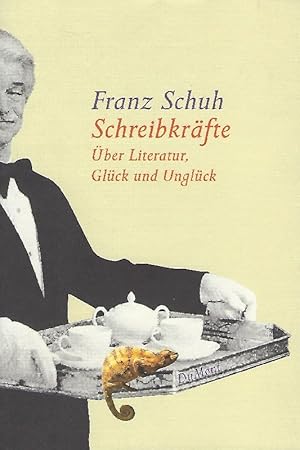In Österreich mag, um bei den Pauschalurteilen zu bleiben, die Gescheitheit verdächtig sein, dafür hat der Sprachwitz beinahe unbegrenzt Kredit. Wer sich auf Karl Kraus beruft und diesem Banner mit Anstand, also eigenständig, zu folgen weiß, hat schon gewonnen. Franz Schuh ist nicht einer, der ständig Witze macht (wiewohl er gut placierte Bonmots zu schätzen weiß). Vielmehr hat seine ganze Sprache Witz, will heißen: Geist und Anmut. Schuh schreibt, wie er spricht. (Nein, nicht: druckreif, was stimmt, was aber für einen Schriftsteller ein zweifelhaftes Kompliment wäre.) Er schreibt und spricht als ein Flaneur, seine Texte haben bei aller Stringenz etwas Vorübergehendes, Vorläufiges, sie stellen, im wörtlichen Sinne, einen Prozeß dar. Seine Sprache scheint gleichsam durch sich selbst zu fließen, sich selbst immer wieder neu zu filtern. Dabei ist es doch kein anderer als Schuh, der siebt, manch Goldkörnlein aufliest, manches ohne Reue wieder verwirft und frisches Wasser auf seine Mühlen leitet.
Aber ist es überhaupt statthaft, die Person Franz Schuh zu betrachten, wo es doch um sein Werk gehen soll? Glücklicherweise ist Schuh Essayist. Als solcher sagt er nicht nur ungeniert „ich“, wenn es zur Sache geht, er gibt in seinem neuen Buch auch einiges Biographische preis, über seine monadische Schreibküchenexistenz etwa, aber auch über das buchstabenferne Milieu seines Elternhauses und über einen Lehrer, der ihm kraft seiner Eloquenz das fluktuierende Eigenleben der Sprache vermittelte. – „Die Sprache macht etwas aus einem Menschen!“ Das Bemühen, quasi die postume Anerkennung dieses verehrten Lehrers zu erringen, und die beflügelnde Idee von der Offenheit des Diskurses sind – laut Schuh – dafür verantwortlich, daß er „aus Begeisterung Essayist“ ist. Diese Begeisterung, das mitunter diebische Vergnügen an der Sprach- und Denkarbeit, überträgt sich mühelos auf den Leser, der Schuhs Urteil – etwa über Thomas Bernhard – nicht teilen muß.
Wer Essays kritisiert, berichtet zumeist, was der Autor sagt, und macht sich so zu dessen Sprachrohr. Ergiebiger kann es mitunter sein zu betrachten, wie er dies tut. Das Herzstück des Bandes ist ein 90-Seiten-Aufsatz über die Literaturkritik mit dem vielsagenden Titel „All you need is love“: Das meint nicht nur das Schicksal der ungeliebten Kritiker, sondern auch den Anspruch der gekränkten Dichter, die von jenen hartnäckig Liebe einfordern (Turrini, Schneider) und dabei an den Falschen geraten sind. Schuh hat aber auch manches Kopfstück für seine Zunftgenossen parat, zum Beispiel für Hellmuth Karasek, der Kraus zitiert, doch dessen Namen nicht buchstabieren kann – Schuh rächt den Meister, indem er den Namen des Frevlers gleich durch zwei Fehler entstellt. (Vorsicht: Je abgeklärter Schuh sich gibt, desto weiter holt er zum Schlag aus!) Nach einem Parforceritt durch die Geschichte der Kritik-Kritik, einer einleuchtenden Kritiker-Typologie und Überlegungen zum Wesen der Kritik als Selbst-Kritik gelangt Schuh zu einem vergleichsweise „pragmatischen Ideal“: Da das Leben kurz und die Bücher lang seien, möge die literarische Kritik „auf die Schonung von Lebenszeit von Menschen“ abzielen.
Daran (und am Essay-Titel) ersieht man: Es geht in diesem Buch, wenn es um Literatur geht, – und manchmal auch einfach so – um Lebensweisheit und Lebensweisen, um Glück und Unglück. Außerdem beschreibt Schuh „Die Kunst der Portraitierens“ und führt sie auch gleich selbst vor: in zwei großartig genauen Aufsätzen über Konrad Bayer und Paulus Hochgatterer. Es gibt literarische Besprechungen von Schuh, in denen alles mögliche (Sozialphänomenologische) besprochen wird, nur nicht die Literatur. Das ist hier nicht der Fall. Wenn Schuh am Beispiel Bayers „Über (literarische) Radikalität“ nachdenkt, scheut er sich nicht, den eigenen Radikalitätsmangel dagegenzuhalten: Die radikalste Literatur ist die, in der der Rede ein Ende gesetzt wird, indem der Redner sich zum Schweigen bringt: „Wer überlebt, hat weitergesprochen.“ Er spricht dann zum Beispiel kenntnisreich und verständnisvoll über radikale Literatur. Radikal in einem wahrhaft einschneidenden Sinn erscheint Schuh auch Paulus Hochgatterers Prosa, der er in dem Essay „Der Autor als Chirurg oder über das Medizinische in der Literatur“ gerecht wird.
In medizinischer Hinsicht ist der Drang, von überall her Fundstücke zusammenzutragen und in ihnen einen geheimen Zusammenhang zu wittern, verdächtig. In ästhetischer Hinsicht ist er äußerst fruchtbar. Franz Schuh ist das personifizierte Einerseits-Andererseits. Seine Devise: „Man muß alle möglichen Antworten in Fragen auflösen, das macht Spaß.“ Er ist der stupend Gebildete und der Fernseh-Trash-Konsument. Er ist Polemiker und Unschuldslamm. Er ist noch in seiner Selbstironie kokett. Er ist einer, der eigentliches Reden für unmöglich hält und der doch dauernd redet, der „Meinungen“ peinlich findet und heimlich doch welche hat. Er ist Philosoph, ein wirklicher im Lichtenbergschen Sinn, kein titulärer, und er schreibt rätselhaft poetische Sätze: „Österreich ist wie jedes Land auf der Welt ganz und gar unverständlich.“ Welch anregende Resignation. Schuhs neues Buch lohnt die Verkürzung von Lebenszeit durchaus.