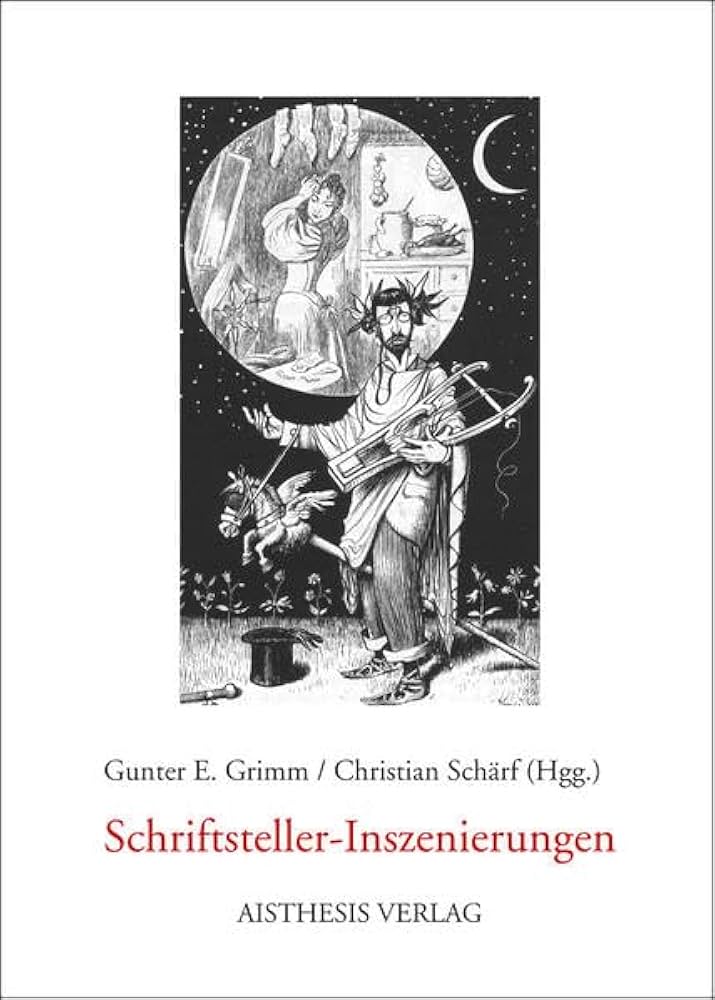Die 16 Beiträge des Bandes greifen ganz unterschiedliche Themen und vor allem Autorenfiguren auf und gehen dabei zum Teil äußerst originell zu Werke. Wenn Christian Schärf über das Verhältnis von „dichterischer Imagologie und Fotografie“ (S. 45) nachdenkt, sehen wir zu Beginn den unglücklichen Hölderlin zu Besuch bei Schiller; er erkennt den dort ebenfalls anwesenden fremden Herrn nicht. Es war der Dichterfürst aus Weimar persönlich, und Hölderlin hat mit seiner pessimistischen Prognose recht behalten, dass sein brummiges Desinteresse seiner Karriere nicht förderlich sein wird. In der Folge geht es Schärf aber weniger um die „Rhetorik der Selbststilisierung“ (S. 46) – also Posen, Gesten, Szenerien –, sondern mehr um einen phänomenologischen Blick auf die „Gespensterhaftigkeit“ der Künstlerfotografie, die sich von der Person und von der Materialität ablöst. Vor Erfindung der Fotografie waren es Bildnisse und Denkmäler, mit denen sich Schriftsteller in das Bildgedächtnis der nachkommenden Generationen einschrieben. Folgerichtig hat das Thema Denkmal Goethe ein Leben lang beschäftigt, wie Rolf Selbmann darstellt. Das nach seinem Tod in Frankfurt errichtete Goethe-Denkmal hätte wohl seinen Beifall gefunden: Der Dichterfürst lehnt sich „selbstischer auf einen deutschen Eichenstamm und blickt auf das Alltagstreiben um ihn herab“ (S. 43).
Als Beispiel eines frühen Popstars der Literatur untersucht Helmut Schmiedt das Phänomen Karl May, zu dessen Erfolg ganz wesentlich die Bildinszenierungen beitrugen, die auf Transgression zwischen Realität und Rolle setzten: der Reiseschriftsteller, der Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi als literarische Erzählfiguren erfindet und im Fotoatelier – übrigens wiederholt in einem Linzer Studio – in diesen Rollen posiert. Als Beispiele zweier konträrer weiblicher Inszenierungsformen untersucht Ruth Florack Else Lasker-Schüler, die ihre Rolle ins Genialische hin anlegt und mit Rollenspielen ihr Privatleben literarisch produktiv zu machen versteht, und Vicki Baum, die über ihre journalistische Tätigkeit für die mondänen Magazine der 1920er Jahre ihre Rolle gewissermaßen zugeschrieben bekommt: Wer über Phänomene wie Mode, Schönheitssaolons und Verjüngungskuren zu schreiben hat, erhöht seine Glaubwürdigkeit gewissermaßen im permanenten Selbstversuch. Wie und weshalb Thomas Mann die „Rolle als kultureller Repräsentant“ (S. 97) von der Weimarer Republik geradezu angeboten bekam, untersucht Walter Delabar, Jan Knopf die „Legenden“ rund um die Person Bert Brechts und Yvonne-Patricia Alefeld die komplexen Selbstsetzungen des Dadasophen Raoul Hausmann – in seinen künstlerischen Selbstporträts wie im wirklichen Leben. Arno Schmidt (Uwe Werlein) und Alexander Kluge als Vorzeigeintellektueller (Chrstoph Ernst) haben eben so ihren „Auftritt“ in dem Band wie Peter Handke (Dieter Heimböckel), Helmut Krausser (Volker Wehdeking), John v. Düffel (Wilhelm Amann) und natürlich Rainald Goetz (Petra Gropp).
Spannend ist Gunter E. Grimms diachroner Blick auf das Phänomen Dichterlesung, das aktuell eine Art Revival erlebt. Für einen ersten Höhepunkt der Autorenlesung sorgten die Performancekünstler Ludwig Tieck oder Friedrich Daniel Schubart. Es war die Zeit der Napoleonischen Kriege; im Abwehrkampf gegen den Usurpator und damit auch gegen die Reste der politischen Öffnung durch die Französische Revolution, verwirrten sich für die Zeitgenossen die politischen Begriffe von rechts und links vielleicht in ähnlicher Weise wie heute seit dem Fall der Berliner Mauer. Solche Perioden, so könnte man vermuten, steigern das Bedürfnis nach „Authentischem“, auch im Umgang mit der Literatur. So weitreichende gesellschaftspolitische Interpretationen liegen Grimm fern – doch aus seiner Analyse zur Optik wie zum soziologischen Ort der Dichterlesung von der Romantik bis in unsere Tage lassen sich doch Befunde in diese Richtung ableiten. Vielleicht hätte mehr Mut oder Interesse in dieser Richtung auch dem Beitrag zum Phänomen Poetry Salm (Stephan Ditschke) gut getan, aber möglicherweise braucht es dazu auch noch einiges an zeitlicher Distanz. Dass Karl Kraus beim Thema Dichterlesung fehlt, ist aus österreichischer Perspektive vielleicht ebenso verwunderlich wie dass es zu Ingeborg Bachmann oder Eflriede Jelinek keinen Beitrag gibt.