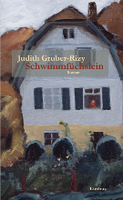Inzwischen hat sie mehrere Romane veröffentlicht, einen Verlag, eine Lektorin sowie Literaturpreise und Stipendien bekommen. Dennoch wagt Rosa auch jetzt noch nicht, „sich Schriftstellerin zu nennen“. Erstens kann sie vom Schreiben nicht wirklich leben. Und zweitens steht ihr viel zu sehr das Motto ihrer Mutter im Weg: „Mehr sein als scheinen“. Rosa hört lieber zu, als dass sie selbst redet; ist „immer klein und bescheiden“ geblieben und beherrscht daher die Kunst der Selbstinszenierung als Künstlerin nicht. Sie wirkt zu „hausbacken und einfach. Burschikos vielleicht manchmal, aber nie extravagant, nie auffällig, nie künstlerisch“.
Erschwerend kommt hinzu, dass auch „kein berühmter Vater, keine berühmt-berüchtigte Mutter, keine berühmten Lehrer, kein berühmter Geliebter“ zur Verfügung stehen, von denen sich die Legitimation als Schriftstellerin schon alleine aufgrund des Namens ableiten ließe, was „in einer Zeit, in der mehr scheinen immer wichtiger“ wird, für das Stattfinden einer Karriere nicht unwesentlich sein mag.
Ungeachtet dessen ist es ihr Ziel, sich als Künstlerin zu etablieren. Bloß trägt sie „ihr Schriftstellerinnen-Sein nicht vor sich her“, sondern lebt im Grunde mehr als Schatten. Rosa fehlt es an Kühnheit und Mut, Grenzen zu überschreiten. Deshalb sieht man in ihr auch mehr eine „Hausfrau, die nebenbei schreibt“; als wäre Schreiben für sie nur „ein Hobby(…), eine Art Laune, ein Zeitvertreib“.
Ist es natürlich nicht. Im Gegenteil. Sie empfindet es als „schwierige, volle Konzentration erfordernde, die gesamte Person fordernde, (…) extreme Arbeit“; zumal es von ihr verlangt, „das Allerinnerste zu geben (und) ganz aus sich herauszugehen“.
Trotzdem hat Rosa gegen die Mehrfachbelastung kaum jemals aufbegehrt, bis an einem 6. Dezember (sie ist einige Tage „allein in der Sommerwohnung in A.“ gewesen) ein im Zug auf dem Fensterplatz gegenüber zurückgelassenes, in einer „mit weißer, gelber, blauer und ganz wenig grüner Stickerei“ verzierten Hülle aus lilarotem Stoff steckendes Buch ihre Neugier erweckt. Sie schlägt es auf, – und schon sticht ihr das Wort „Schwimmfüchslein“ ins Auge, das sogleich „die Sehnsucht nach dem Märchen vom Geliebtwerden“ in ihr weckt.
Rosa nimmt das Buch (es handelt sich um eine Biografie über Gabriele Münter und Wassily Kandinsky) letztlich an sich. Denn sie will „dem Schwimmfüchslein auf den Grund gehen“.
„Schwimmfüchslein“ ist der Kosename von Gabriele Münter. Kandinsky nennt sie so, nachdem ihm, als er sie beim Schwimmen im See beobachtet, auffällt, dass „ihr brünetter Schopf im Wasser rötlich“ schimmert.
Während ihrer Beschäftigung mit dem „Schwimmfüchslein-Buch“ lässt sich Rosa ins „Schwimmfüchslein-Leben“ hineinziehen, das zwar ganz anders ist, „doch voller Parallelen, voll gleicher Sehnsucht nach Kreativität“. Ihnen und ihr trägt Judith Gruber-Rizy gekonnt Rechnung. Sie verstrickt die beiden Schicksale schön ineinander und liefert den programmatischen Hinweis mit: „Aus einzelnen Fäden, kleinen Teilen ein festes Ganzes weben. Verdichten. Alles hineinweben. Alles verwenden und einbauen. Beziehungsgewebe schaffen. Beziehungsnetze“.
Rosa beißt sich am Schicksal der Malerin regelrecht fest, „saugt alles und jedes genau in sich auf“, bis sie ein Jahr später schließlich den Entschluss fasst, „einen Roman über Schwimmfüchslein zu schreiben“, der natürlich auch autobiografisch sein wird, weil eben einfach „alles irgendwie autobiografisch“ ist, was Rosa schreibt.
Gleiches könnte man auch von Judith Gruber-Rizy behaupten, die sehr gefühlvoll und emphatisch davon berichtet, was es für Frauen heißt, ihre Kreativität zu leben. Ende des 19. Jahrhunderts können sie auf keine Akademie, weil Männer, die damals im Kunst- und Lehrbetrieb etwas zu sagen haben, noch davon ausgehen, dass es „widernatürlich sei, wenn Frauen (…)kreativ sein wollen“. Gabriele Münter lässt sich davon nicht beirren. Sie kämpft unverdrossen „um sich, um ihre Malerei, um ihre Ausbildung, um ihre Freiheit, um ihre Möglichkeiten“. Denn sie hat Ziele und will sie erreichen. Doch muss eine starke, von sich überzeugte Frau leider damit rechnen, von Männern für völlig unerträglich gehalten und in ihrer Kunst lächerlich gemacht zu werden.
Davor scheint man auch 100 Jahre nach Gabriele Münter nicht gefeit. Gerade wenn jemand ängstlich ist und nicht selbstbewusst genug wie Rosa, ist die Wahrscheinlichkeit, „auf Anpassung programmiert“ zu werden, groß; was Judith Gruber-Rizy an ihrer Protagonistin, deren Leben einem einzigen Anpassungsakt gleicht, überzeugend und eindringlich vorführt. Rosa hat sich nie auch nur die kleinste Abweichung „vom geraden Kurs“ gegönnt, als wäre sie die ganze Zeit „auf Schienen“ unterwegs gewesen. In der Beschäftigung mit „Ella-Gabriele“ wird ihr das alles bewusst.
Nicht von ungefähr erscheint Rosa das Buch auch wie „eine lebendige Person“. Und im Laufe ihrer Lektüre spiegelt sich die Schriftstellerin darin immer klarer. Irgendwann sieht sie „zwei wilde und trotzige Frauen, die um ihre Kunst und gegen die totale Vereinnahmung kämpfen“. Rosa findet sich „im Schreiben immer stärker selbst“, während sie sich „im gleichen Ausmaß vom Ehemann“ und der Vorgabe, nach seinen Entwürfen zu leben, entfernt. Rosa „hat ihre eigenen Entwürfe“, die jedoch untrennbar verbunden sind mit dem Gefühl, sie „nicht umsetzen zu können“.
Judith Gruber-Rizy hat dieses Gefühl auf die Künstlerinnenebene projiziert und dabei ein fein ziseliertes Sprachgemälde geschaffen, dessen Stil zu elliptischen, Satzteile einsparenden Konstruktionen tendiert. Inhaltlich ist es auf den Emanzipationsversuch einer Frau als Schriftstellerin im Spannungskreuz Familie-Ehe-Gesellschaft fokussiert, der zeigt, dass Männer immer noch die Frauen klein machen, als ob das Diktum: „Mann und Schreiben ist gleich Beruf. Frau und Schreiben ist gleich Fragezeichen“, nach wie vor uneingeschränkt gelten würde.
Judith Gruber-Rizy vermag dem allerdings einiges entgegenzuhalten.