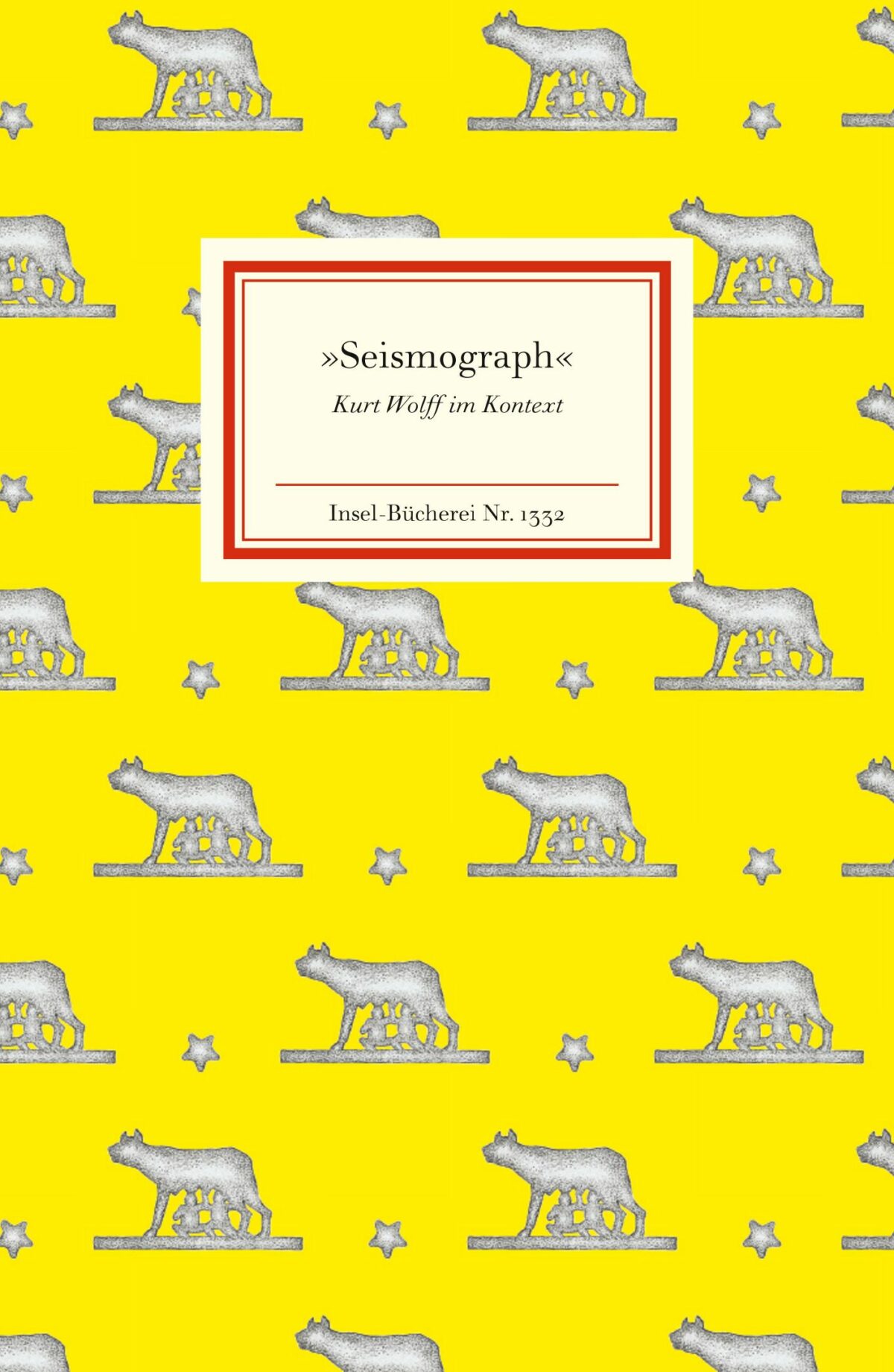Der Begriff entstammt einem Brief Kurt Wolffs an Karl Kraus vom 14. Dezember 1913, in dem er die Rolle des Verlegers definiert „als Seismograph, der bemüht sein soll, Erdbeben sachlich zu registrieren. Ich will Äußerungen der Zeit […] notieren und für die Öffentlichkeit zur Diskussion stellen. (Seismograph nicht Seismologe sein.)“ (S. 65) Wolffs Brief ist eine Rechtfertigung, denn Kraus hatte ihm vorgeworfen, dass er auch Bücher von Max Brod verlege, der ihn, Kraus, so schändlich diffamiert habe.
Das ist ein nettes Aperçu zur schwierigen Beziehungsgeschichte Verleger/Autor, für das vorliegende Büchlein allerdings eher marginal. Denn was den Inselband eigentlich spannend macht, ist ein Stück Geschichte des deutschsprachigen Verlagswesens, es geht also vor allem um den Untertitel Kurt Wolff im Kontext.
Konzentriert ist das Geschehen dabei auf die Jahre kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als die großen deutschen Verlage fast gleichzeitig nach neuen Konzepten suchten, in Analogie zu etablierten erfolgreichen Billig-Reihen. Reclams Klassiker Bibliothek war 1867 gestartet und stellte 1912 die ersten Buchautomaten auf, designed übrigens von Peter Behrens, der 1899 das Signet des Insel Verlags entworfen hatte: ein Segelschiff als notwendiges Transportmittel zur Insel genauso wie als Bild für das Buch, das mit geblähten Segeln in die weite Welt der Leser aufbricht. Im Unterhaltungssektor gab es seit 1884 Engelhorns Allgemeine Roman-Bibliothek.
Drei Jahre später startete Samuel Fischer die Collection Fischer, 1908 folgte die Bibliothek zeitgenössischer Romane, die Originalausgaben aus dem Programm zu reduzierten Preisen nachdruckte. Eröffnet wurde die Reiche mit Theodor Fontanes Ehebruchsroman L’Adultera. Dass Fontane hier auf das erwartbare letale Ende der Ehebrecherin verzichtet und sie mit einigen Stolpersteinen im neuen Leben gut ankommen lässt, ergibt letztlich eine ganz eigene Radikalität. Die Schuld wird nicht gesühnt, also die bürgerliche Moral nicht wieder restauriert und die Gesellschaft damit gezwungen, mit dem ,Vorfall‘ längerfristig – also anders als bei einer kurzen Empörung über einen Skandal – umzugehen. Das Buch blieb das einzige eines älteren Autors in der Fischer Reihe der Zeitgenossen.
1910 startete Ullstein seine Reihe der 1 Mark Romane, spezialisiert auf den Zeitroman und heute eine Fundgrube für vergessene AutorInnen der Neuen Sachlichkeit. Und 1912 erschien der erste Band der Liebhaber-Bibliothek des Insel Verlags, die in Abgrenzung zu billig produzierter Romanware auf sorgfältige Buchgestaltung setzte und auch auf erlesene Inhalte, Neues ebenso wie Vergessenes, denn: „In dem oft geschüttelten Sieb ist Stoff erlesener Art für unbeschränkte Zeit geblieben.“ (S. 31) Und dieser Stoff füllt die Insel-Bücherei letztlich bis heute.
1913 startete auch Kurt Wolff seine Reihe Der jüngste Tag, die als Alleinstellungsmerkmal auf Debüts setzte und dabei wohl auch dank der Lektoren Franz Werfel, Walter Hasenclever und Kurt Pinthus der Seismographen-Rolle gerecht wurde. Unter den ersten zehn Bänden waren immerhin Kafka, Emmy Hennings, Carl Ehrenstein, Georg Trakl oder Berthold Viertel vertreten. Bis 1921 erschienen 86 Bände. Auch wenn Kurt Wolff in allen Werbetexten betonte, das Programm „werde keinesfalls von einer Autorenclique beherrscht“ (S. 42), geriet das Projekt in der Außenwahrnehmung vom Zeitpunkt der Gründung her automatisch in den Geruch eines Expressionisten-Verlages.
Beeindruckend ist an dieser ersten Hälfte des Bändchens die Dichte und Bandbreite der verlegerischen Reihenaktivitäten, die heutige Leser vor Neid erblassen lassen könnte. Die zweite Hälfte des Bandes ist Wolffs weiterem Leben und Wirken gewidmet. Interessant sind hier die langen Auszüge aus seinem Kriegstagebuch 1914 bis 1916 (S. 48-53). Das erklärt den Werbetext, den Kurt Wollf 1928 dem kaum mittelmäßigen Frontroman von Hans Herbert Grimm mit dem burlesken Titel Schlump. Geschichten und Abenteuer aus dem Leben des unbekannten Musketiers Emil Schulz, genannt ,Schlump‘ beigab: „soviel wie hier, werden sie schon lange nicht mehr gelacht haben“, und die Frage: „Haben Sie Schlump schon gelesen? […] wird man bald in allen Männerkreisen zu hören bekommen.“ Dass Kiepenheuer & Witsch genau dieses Buch zum Gedenkjahr 2014 als „grandiosen Antikriegsroman“ ankündigte, ist damit freilich noch nicht erklärt.
Schon kurz nach seiner Freistellung vom Kriegsdienst startete Kurt Wolff neue Buchreihen – nicht mehr exklusiv orientiert auf das Schlagwort des „Jüngsten“, sondern auf das etwas gemäßigtere „Zeitgenössisch“. Als sich Stefan Zweig Ende 1918 beim Insel Verlag beschwert, Kurt Wolff sei PR-mäßig wesentlich aktiver, antwortet Anton Kippenberg dennoch mit Blick auf Wolff: „Der Tanz um die sogenannten jungen Dichter ist eine der allerunerfreulichsten Erscheinungen unserer Zeit, und gerade die guten Dichter werden einmal einsehen, wie ihnen dadurch geschadet wird.“ (S. 63)
Dass das Abenteuer mit einem 1916 gestarteten Imprint exklusiv für Karl Kraus nicht gut ausgehen konnte, lag sicher nicht an Kurt Wolff, der sich in den ökonomisch schwierigen Jahren Mitte der 1920er Jahre aus dem Verlagsgeschäft zurückzog. Im amerikanischen Exil gründete er 1945 den Pantheon Verlag, der 1958 ebenfalls aus finanziellen Problemen scheiterte. Die Insel-Bücherei aber ist mit diesem Band – trotz wiederholt drohender Einstellung – bei Nummer 1332 angelangt.