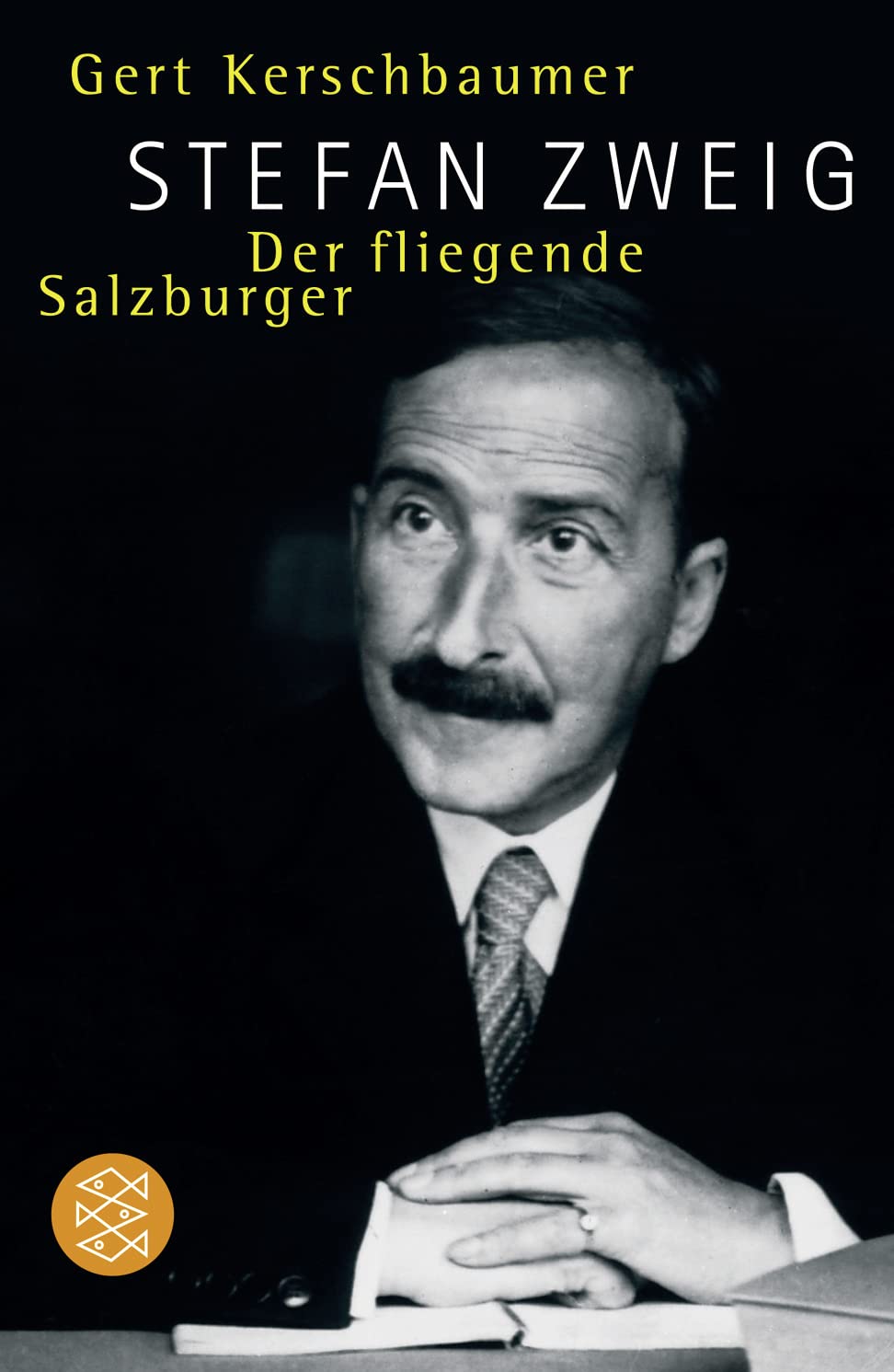Aber macht er es sich nicht damit zu leicht? Er verallgemeinert, wo Differenzierung angebracht wäre und er bestätigt Vorurteile, statt sie in Frage zu stellen. Wie ist „der Dichterwald des Kronlandes Salzburg“? Knorrig! Die Obrigkeit ist verknöchert, die Zensur moralinsauer, Salzburg stockkatholisch. Natürlich hat Kerschbaumer Recht, aber warum hämmert er es dem Leser in der Tradition eines Ideologen ein, der keine Argumente hat, nur seinen blinden Glauben an etwas vermeintlich Höheres?
Aber Kerschbaumer hat tatsächlich Neues anzubieten, und das macht die Qualitäten des Buches aus. Zwischen 1919 und 1934 lebte Stefan Zweig in Salzburg. Kerschbaumer schreibt Lokalgeschichte aus weltgeschichtlichem Impetus. Ihm geht es nicht um die Provinzstadt und wie sie mit einem Schriftsteller von Rang verfahren ist, sondern im Kleinen spiegelt sich der Geist einer ganzen Epoche. Das ist das eigentlich Aufregende an diesem Buch, zu sehen, wie am individuellen, überschaubaren Fall die große Geschichte wirksam wird und wie innerhalb der Diretktiven eines geschichtsmächtigen ideologischen Programms Eigenheiten und Abweichungen sichtbar werden.
Das Buch beschreibt die Geschichte einer Verdüsterung. Es bleibt nahe an der Person Stefan Zweigs, dessen Motive, in Salzburg zu bleiben und dessen private Verworrenheiten ebenso ihren Platz bekommen wie das Klima einer Stadt, das für einen jüdischen Weltbürger keine Zukunft bietet. Der Schriftsteller, der sich in Salzburg „nur einigeln und am weiten Horizont orientieren“ möchte, steht auf verlorenem Posten. Er weigert sich, wie aus einem Brief von 1920 an Hugo von Hofmannsthal zu erkennen ist, vor der „Salzburger Literarischen Gesellschaft“ aufzutreten oder eine Festrede zu halten. Aber wie soll eine gefragte Persönlichkeit im Sommer, da noch dazu ab 1920 die Festspiele Salzburg zu einem kulturellen Mittelpunkt machen, gelassen seinen Plänen nachgehen? Und als sich nach und nach die völkischen Beobachter lautstark zu Wort melden und tatkräftig an einer rassereinen Kultur und Gesellschaft arbeiten, hat Zweig endgültig verloren. Im Februar 1933 schreibt er in einem Brief nach Wien: 2Es herrscht jetzt eine Art Böswilligkeit in der Welt, die unerträglich ist. Kippenberg, mit dem ich eben telefonierte, sagte mir, dass die Buchläden und Theater infolge der politischen Lage vollkommen verödet sind: eine greuliche Zeit und vielleicht doch noch besser als diejenige, die kommen wird.“
Von mehreren Seiten beleuchtet Kerschbaumer den Schriftsteller, der auf dem Sprung zum Weltruhm ist. Der private und der öffentliche Zweig bekommt ebenso Gestalt wie der Autor, der seine literarischen Wahlverwandtschaften pflegt und zu seinen Abneigungen steht. Ein Buch über Stefan Zweig, das gleichzeitig einen Blick in eine Welt im Umbruch wirft – ein die Gedanken in Schwung versetzendes und sehr nützliches Buch.