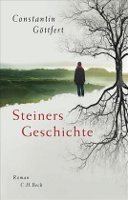Lange Zeit galt es in der österreichischen Literatur aber als geradezu unschicklich, den Heimatbegriff positiv aufzuladen, zu sehr war die Heimatliteratur zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus konservativ und altbacken, die Romane nah am Klischee eines Landidylls, aufgeladen später mit Blut- und Bodenromantik. Die linke Literatur der Siebzigerjahre versuchte eine Abgrenzung zu diesem Heimatbegriff, etwa Peter Turrini mit seiner Alpensaga, in der die Dorfbewohner vorwiegend als böse und hinterhältig oder schlicht dumm dargestellt wurden. Später kamen die Schilderungen der Dorftristesse hinzu, etwa durch die Innerhofer-Romane oder Erinnerungen von Schwabenkindern oder einfachen Mägden.
Selbst in Robert Schneiders Weltbestseller Schlafes Bruder ist das Dorf feindliches Gebiet, die Bewohner Ignoranten, an denen die feinfühligen Genies scheitern müssen. Klar und schnörkellos, wenngleich ebenso am Leben leidend war etwa Reinhard Kaiser-Mühleckers beeindruckendes Debüt Der lange Gang über die Stationen. Sein Roman leitete eine Retro-Welle des modernen Heimatromans ein, der das Skurrile und Schrullige in den Vordergrund rückt. Literarisches Stilmittel war etwa bei Vea Kaisers Blasmusikpop oder Kurt Palms Bad Fucking eine alles übertünchende Ironie. Die Heimat als Folie für den billigen Kalauer.
Dass es zwischen all diese Facetten des Heimatromans noch eine weitere Variante geben kann, beweist Constantin Göttfert mit seinem großen Roman Steiners Geschichte, denn Heimat kann auch ganz unprätentiös, zurückhaltend und ohne große Ab- oder Aufwertung der einzelnen Figuren erzählt werden. Der Heimat wird in Göttferts Roman ein ganz neuer, weder moralisierender noch heimattümelnder Raum zugewiesen. Das ist beruhigend und die Leistung dieses Romans.
Constantin Göttfert ist ein leiser, feinsinniger Erzähler, der seinen Figuren jenen Raum gibt, den sie benötigen, um ihre schweren Geschichten auszubreiten. Denn das Thema von Steiners Geschichte ist komplex und schwer. Es geht um das Paar Ina und Martin, die sich als Junglehrer kennenlernen. Sie werden, zögerlich, ein Paar, was vor allem daran liegt, dass bei Ina die Familiengeschichte ins Private hineinragt. Inas Vorfahren sind Karpatendeutsche, die am Ende des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat vertrieben wurden und die sich in der Gegend des Marchfelds erst eine neue Existenz aufbauen mussten. Die Reaktion des Familienpatriarchen, der ein Leben lang den Verlust des Steinerhofes nicht verwinden kann, ist in erster Linie beharrliches Schweigen; und ein Verharren in der Vergangenheit. Das Glücken einer Beziehung vor diesem Hintergrund steht naturgemäß auf wackligen Beinen; tatsächlich macht sich Ina, kaum schwanger, auf die Suche nach ihrer Herkunft jenseits der Grenze; Martin versucht ihr zu folgen. Aber es sind viele Wege, die diese beiden zu gehen haben, denn um ihrer Zukunft willen müssen sie erst die Vergangenheit verstehen lernen. Nach dem Tod des Patriarchen Steiner, der auch in die NS-Zeit als Täter verstrickt ist, sucht Ina in der Nähe der ehemaligen Heimat nach einem kolportierten Schatz, den Steiner versteckt haben soll. Es scheint so, als wäre der Versuch von Heimat immer eine Irrfahrt, die man sich erst erschließen muss. Heimat spielt sich immer in einer Art Grenzsituation ab, und die March eignet sich dazu vorzüglich.
Ehemals Grenze zum Osten und dem Kommunismus, Grenze zum Ende der Welt, spielt der Fluss eine doppelte Rolle. Anstatt als Metapher des Lebens, des allgemeinen Flusses menschlicher Beziehungen, ist diese March Inbegriff für den Stillstand, der jahrzehntelang das Leben zwischen den verfeindeten Ländern bestimmt hat. Besonders schön gelingt Göttfert eine Stelle am Beginn des Buches, als Ina mit ihrem Großvater der March entlang spazieren geht. Auf der anderen Seite schieben vier junge Soldaten Grenzdienst, bis sie durch Geräusche alarmiert werden. Jemand ist im zugefrorenen, winterlichen Fluss eingebrochen, Gewehre werden gerichtet, Rufe gehen hin und her, hektische Bewegungen. In einem Moment, in dem alles winterlich still zu sein scheint, bricht mit einem Mal die ganze welthistorische Ignoranz und Brutalität ein. Einen Moment vorher hat der alte Steiner seine Finger zur Pistole gehoben gehabt, als Ausdruck für den ganzen Hass, den er empfindet. Plötzlich geht es um einen vermeintlich Flüchtenden. Göttfert erzählt diese Szene mit einer geradezu scheuen Eleganz und Zurückhaltung, die ganz ohne Wertung auskommt, Begriffe wie Schuld oder Wiedergutmachung werden angesichts des leisen Erzähltons zweitrangig. Dabei verhandelt Göttfert große Themen, für die der Autor – man merkt es dem Roman stark an – akribisch recherchiert hat. Bei sudetendeutschen Heimatverbänden, bei ehemaligen Siedlern vor Ort. Doch Göttfert übernimmt weder das Geschichtsurteil der einen noch das der anderen Seite. Er versucht zu verstehen. Wie das war, als die große Weltgeschichte einen Riss durch die Familien gezogen hat, gerade dort, wo für Hitler und die Nationalsozialisten der Lebensraum im Osten entstehen sollte und wo am Ende viele ohne Heimat dastanden und in die Fremde gehen mussten.
Die Szene übrigens endet so, wie vieles bei Göttfert endet, im Vagen, im Unentschieden. Der vermeintliche Flüchtling an der March entpuppt sich als eingebrochenes Wildschwein, das in Todespanik und nach langem Kampf aus dem Eis entkommen kann und in den Wald verschwindet. Das wünscht man sich auch für die getriebenen und heimatlosen Figuren in Constantin Göttferts Roman, man wünscht ihnen am Ende eine Heimat; und sei es um der Kinder willen.