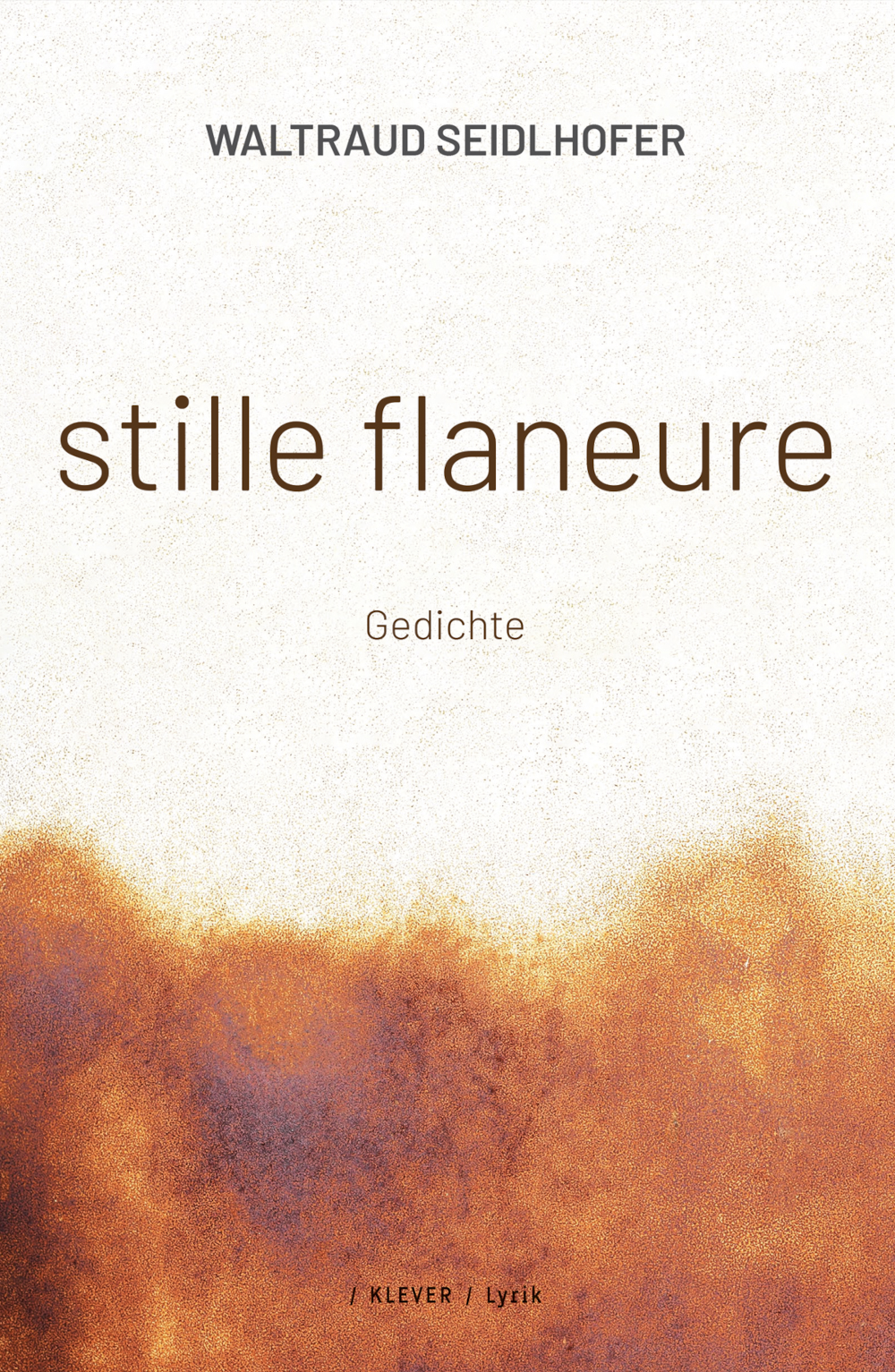1939 in Linz geboren begann Waltraud Seidlhofer in den späten 1950er Jahren mit ihrer literarischen Arbeit und veröffentlichte 1961 ihr erstes Gedicht in der Zeitschrift Neue Wege. Erst 10 Jahre später legte sie mit bestandsaufnahmen ihr Lyrikdebüt vor. 1976 folgte ihr Prosadebüt fassadentexte in Heimrad Bäckers edition neue texte. Seither veröffentlichte sie zahlreiche, meist schmale Gedicht- und Prosabände, mit denen sie ihren Ruf als experimentelle, sprachreflexive Schriftstellerin festigte. Es ist ein Geschenk für alle, die an avancierter Dichtkunst interessiert sind, dass Seidlhofer 63 Jahre nach Publikation ihres ersten Gedichts weiterhin schreibaktiv sein kann und nun unter dem Titel stille flaneure einen neuen Lyrikband veröffentlicht hat.
Die Figur des meist gut betuchten Flaneurs, der ziel- und planlos durch Städte bummelt, seine Blicke schweifen lässt und absichtslos Eindrücke sammelt, hat in zahlreiche literarische und philosophische Werke männlicher Autoren Eingang gefunden. So erleben wir etwa in Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit die Eindrücke eines Flaneurs:
„… fühlte ich manchmal meine Aufmerksamkeit plötzlich gefangen von einem Dach, einem Sonnenreflex auf einem Stein, dem Geruch eines Wegs, … ein spezielles Vergnügen, das wohl daher kam, dass sie aussahen, als hielten sie hinter dem, was ich sah, noch etwas verborgen, das sie mich zu suchen aufforderten, und das ich trotz aller Bemühungen nicht zu entdecken vermochte. Da ich genau fühlte, dass es in ihnen war, blieb ich unbeweglich stehen, um sie anzuschauen, um den Versuch zu machen, mit meinem Denken über das Bild oder über den Duft noch hinauszugelangen … indem ich meine Augen schloss; ich konzentrierte mich völlig darauf, genau die Linie des Daches, den exakten Farbton des Steines wiederzufinden, die, ohne dass ich begreifen konnte, warum, mir mit etwas angefüllt schienen und bereit, sich zu öffnen, um mir auszuliefern, wovon sie selbst nur die Hülle waren.“ (Bd 1, Unterwegs zu Swan, Ü: Eva Rechel-Mertens, Suhrkamp 2011, S. 260)
Der Schriftsteller Florian Neuner hat einst Waltraud Seidlhofers Literatur als „eine Literatur des Blicks“ bezeichnet, die ihren Ursprung im genauen Hinsehen habe (Die Rampe – Porträt W. S, Linz 2000; S. 59). Doch wie Prousts Flaneur strebt sie nach dem genauen Hinsehen eine andere Art der Wahrnehmung an, die entsteht, wenn man die Augen schließt, um besser sehen zu können und die zugleich die betrachtende Person und die Zeit verlangsamt.
Bei Proust wie bei Seidlhofer verschränken sich das Gehen, Denken, verinnerlichte Wahrnehmung und das Schreiben auf der Suche nach Wahrheit und Erkenntnis. Die Dinge verwandeln sich, werden anders, als sie zunächst erscheinen. Das Gesehene verschmilzt mit Phantasien, Träumen oder Erinnerungen und durch diese Verbindung ist etwas Neues im Begriff zu entstehen, ein Vorstellungsraum, „in dem / woerter sich reih[t]en)“. (S. 20)
Zwischen Orten, Eindrücken und Begegnungen werden Fäden und Linien gezogen, die mit den Möglichkeiten der eigenen literarischen Sprache weitergesponnen und zu einem Netz assoziativer Bezüge verwoben werden, in dem auch surreale Wendungen Platz finden.
Das Proust’sche Flanieren war im 19. Jahrhundert ein Privileg begüterter Männer. Frauen verfügten selten über eigenes Vermögen und wenn sie unbegleitet in der Öffentlichkeit flanierten, galten sie als Prostituierte. Diese traditionellen Bilder brachen im Lauf des 20. Jahrhunderts allmählich auf, als Künstlerinnen wie die Autorin Virginia Woolf oder die Filmemacherin Agnès Varda flanierten und weibliches Flanieren auch in der Kunst als Akt der Weltaneignung thematisiert wurde, etwa in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen. Doch bis heute ist das absichtslose Herumstreifen einer Flaneuse, einer Flaneurin in weiten Teilen der Welt nicht selbstverständlich und die Präsenz flanierender Männer im öffentlichen Raum wie auch in der Literatur deutlich größer.
Doch wer sind die Flaneure in Waltraud Seidlhofers aktuellem Lyrikband? Im Gedicht flaneuse stellt der Titel klar, dass es sich um eine Frau handelt, die wie Prousts Flaneur sich Freiraum und Freiheit gibt und durch Straßen wandelt. Auch der Name Virginia Woolf und damit der einer frühen Flaneuse wird assoziativ genannt. Ebenso kann man in manch anderen Texten, die durch das Fehlen eines Ich, Du oder Wir entpersonalisiert sind, davon ausgehen, dass es sich um eine Frau, nämlich die Schriftstellerin selbst, handelt, eine Meisterin der Aussparung, die in den sieben Kapiteln des Buchs von ihren Wegen durch die und mit der Sprache und deren Setzungen erzählt.
Seidlhofer tippt ihre Texte mit einer älteren Schreibmaschine, auf deren Tastatur die Umlaute fehlen. Das erste Kapitel moments I beginnt mit einem Zyklus aus drei Gedichten. Im zweiten heißt es:
„reduktion
wird als programmpunkt
verwendet
zwischen buechern
und bildern
werden atemzuege
probiert
noch gibt es luft
woerter zu fuellen
und der raum
wird als mantel
um die schultern
gelegt“ (S. 8)
Diese Reduktion tritt auf zumindest dreierlei Weise in Erscheinung. Zum Einen gibt es krankheitsbedingte Einschränkungen, die auf ein absehbares Ende verweisen, denn der Ausdruck „noch gibt es luft“ impliziert die Frage: wie lange noch? Zum Zweiten erzwingt die körperliche Mühsal eine andere Form des Flanierens, nämlich das Spazierengehen im Zimmer „zwischen buechern und bildern“, auch zwischen Namen und Erinnerungen, vielleicht noch selbständig auf zwei Beinen oder nur mehr mit Augen, Ohren und in Gedanken. Zum Dritten tritt uns die Reduktion in fast jedem einzelnen Text des Bands als extreme Verdichtung entgegen, wo kaum noch mehr Verknappung möglich ist.
Seidlhofers Verse sind kurz, meist ein bis drei, selten vier Wörter lang, ebenso die Gedichte, die, linksbündig gesetzt, selten eine ganze Seite füllen. Eine Ausnahme gibt es im fünften Kapitel muster, wo die Gedichtstruktur aufgebrochen wird und die wenige Verse kurzen Strophen über die Buchseiten verstreut sind, was den Eindruck einer Bewegung erzeugt.
Seidlhofer ist „in den zimmern“ (S. 11), doch nicht weltabgewandt. Bereits im ersten Kapitel holt sie die Corona-Pandemie ins Gedicht mit einem Fragment aus den Weltnachrichten, wenn es heißt: „in venedigs kanaelen / schwimmen wieder / delphine“. (S. 11) Im Kapitel remembrance wiederum werden Erinnerungen an frühere Reisen Anlass für ein Gedicht: „taeglich / werden andere szenen / aus dem gedaechtnis / geholt“ (S. 31). Es sind Zitate und „details / die das gehen“ (S. 55) einst begleiteten bei früheren Aufenthalten in Paris, in einem Dorf im Loiretal oder in Sydney, wobei bei einigen Texten die Jahreszahl 2020 unterstreicht, dass es Erinnerungen sind, weil es wegen des damaligen Corona-Lockdowns keine realen Reisemöglichkeiten gegeben hat. Es ist „ein echo von stimmen“ (S. 16) und von Stimmungen.
Etliche Gedichte thematisieren Variationen von Verfall und Vergänglichkeit. „ruinenlandschaften“ (S. 44) tauchen auf, Welten zerbröckeln so, „dass splitter blieben“ (S. 45), Holz verwittert „in fasrige / spaene“ (S. 44) und auch die Frage nach der Haltbarkeit des Geschriebenen wirft die Lyrikerin wiederholt auf. Im vierten Kapitel schreiben geht sie der Frage nach der Autonomie der Erschaffenden nach, weil sich das Geschaffene auf einmal widersetzt und selbständig macht. „aufzeichnungen / loeschen sich / waehrend des schreibens“ (S, 59), es „loesen sich zeichen / aus ihrem kontext“ (S. 60) oder es „fallen begriffe / ueber uns her“ (S. 61).
So ist es nur vermeintlich die Schriftstellerin, die flaniert und dabei ihre Gedichte entstehen lässt. „buchstaben / gleiten / aus zeilen“ (S. 48), Wörter machen sich auf eigene Faust auf, um zu flanieren und stellen dabei den Schriftstellerinnentext auf den Kopf. Motive, die man aus Seidlhofers früheren Texten gut kennt, wie Licht, Klang, Träume, Straßen sowie geometrische Begriffe scheinen aktiv durch ihren Text zu streifen, ja sogar „absatze flanieren / und streunen / durch zeilen“ (S. 64) in Seidlhofers faszinierendem Spiel mit Wörtern und Versen.
Monika Vasik, geb. 1960, Studium der Medizin an der Universität Wien, Promotion 1986; Lyrikerin, Rezensentin, Ärztin; Literaturpreise u. a. Lise-Meitner-Preis 2003, Publikumspreis beim Feldkircher Lyrikpreis 2020; Mitbegründerin und bis 2022 Mitverantwortliche der Poesiegalerie; mehrere Lyrikbände, zuletzt: hochgestimmt (Elif Verlag, 2019) und Knochenblüten (Elif Verlag, 2022). www.monikavasik.com