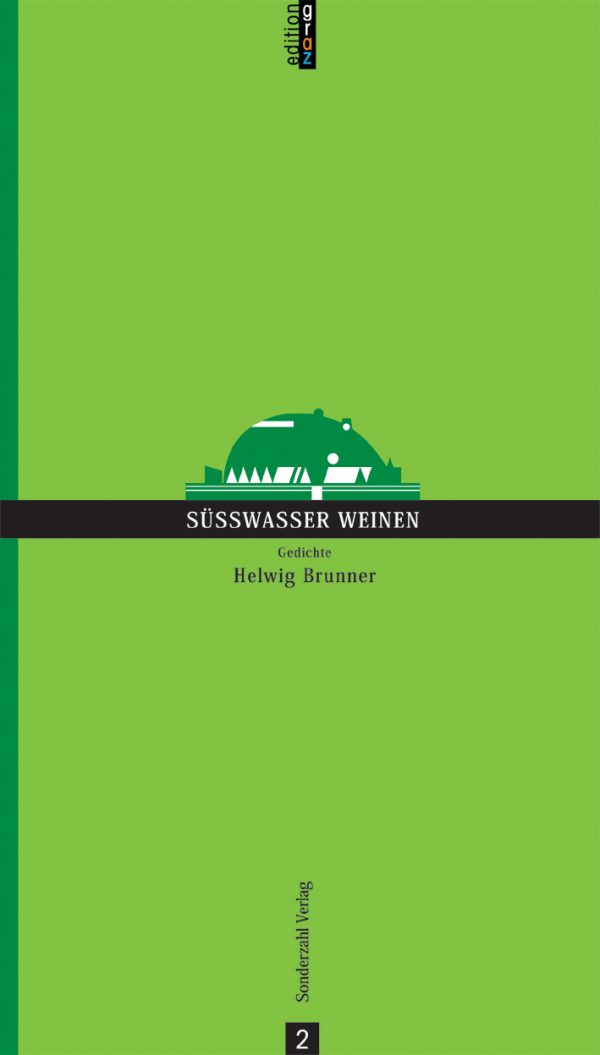Und beim Blättern und Lesen wird schnell klar: Hier verdichtet und erhebt sich die Sprache, im Alltag oft nur Sand und Wüste, Seite für Seite zu einer Düne, die auf poetisch hoch konzentrierte Weise weite Ausblicke und tiefe Einsichten in die Sprache und die Welt eröffnet und an deren Spitze, wo sich Helwig Brunner hier wie in seinen anderen Buchveröffentlichungen bewegt, sich nicht nur einzelne Grasbüschel zeigen, sondern eine ganze wohltuende Oase, die das Ich, das lyrische wie das lesende, „hier mit sich im Grünen sein“ (ebd.) lässt, im Saftigen, im Frischen, im Lebendigen.
An der Gesamtkonzeption, der Makrostruktur des Bandes, der Lyrik aus den Jahren 2001 bis 2007 enthält, fällt zunächst einmal das Gestaltungsprinzip der Triade auf: Die Gedichte sind nicht nur in die drei Abschnitte „Naturalien“, „Musikalien“ und „Destillate“ unterteilt, sie sind auch konsequent, ob sie nun kürzer oder länger sind, in drei Strophen gehalten. Nun ist die Triade ein wesentliches Strukturelement im menschlichen Denken, in der Religion, in der Philosophie und vielen weiteren Wissenschaften, von der Dialektik und formalen Logik bis zur Psychoanalyse und Semiotik, womit auch ein Bezugskoordinatensystem für die Gedichte gegeben ist. Ein weiteres, eigentlich zuerst zu nennendes liegt in der Biografie und den Tätigkeitsbereichen Helwig Brunners, der Biologe („Naturalien“), Konzertviolinist („Musikalien“) und Schriftsteller („Destillate“) ist.
Die hier versammelten Gedichte erfüllen über alle Maßen das, was der Autor selbst für einen lyrischen Text als Qualitätskriterien einfordert, poetologisch explizit dargelegt in „Gedicht, offen/dicht“ (S. 20 und Leseprobe): Sie halten dicht, sie muten uns etwas zu, sie vergessen die Methode, sie leugnen den Inhalt, sie lassen die Form zerfallen und sie stehen nach oben offen, wie in der nach oben offenen Richter- respektive Dichterskala. Sie vermitteln beim Lesen das Gefühl, dass kein Wort zu viel oder zu wenig gesagt wird und kein formales Mittel, sei es Reim oder Wortspiel, wird als Selbstzweck oder manieristisch betrieben, sondern behutsam nur an Stellen, wo es erforderlich ist, sozusagen songdienlich eingesetzt. Oft sind es raffinierte Paragramme und Annominationen, bei denen am Ausgangswort sogar nur ein Buchstabe verändert wird, um es in der Poesie einrasten zu lassen („Weltblechdach“, S. 31) und dabei auch Mängel der Alltagssprache zu beheben, wenn etwa aus der „Sehnsucht“ die viel eindringlichere „Sehnsuche“ (S. 13) wird. Nur da und dort, in ganz wenigen Passagen schleicht sich ein Hauch Pathos ein – durch die Verwendung von kategorischen Bezeichnungen wie „immerweiß“ (S. 32) – immerhin nicht „ewigweiß“ – oder wenn die Sprache auf den Schmerz kommt, wie im an und für sich sehr schönen Vergleich der Schrift mit einer „Wundkruste, / die ein Schmerz dort notiert hat“ (S. 98) oder schon beim etwas sakral anmutenden Buchtitel „Süßwasser weinen“ aus dem Gedicht „Küchenschau mit Zwiebel“ (S. 72), in dem Wasser nicht auf die Mühlen, sondern aufs Messer gegeben wird. Viele andere Stellen entkräften diesen Eindruck wieder, wie im Gedicht „in Kurzsicht, entblödet“ (S. 103), dessen Schlussstrophe die Dichtung zurück auf den Boden holt: „Beipackzettelliteraturen: und lesen, ver- / lesen das Schlusswort, Gewohntes von / Anfang an, lippenkraus und bauchbetont, / der gummiarmierte Fick mit Silbentrennung / und immer die Dreifaltigkeit der Poesie“ (ebd.)
Der Abschnitt „Naturalien“ fokussiert auf den Sehsinn – Bilder werden nicht nur eingefangen, sondern durch Sprache gesetzt, im Mittelpunkt steht das Ich im Dickicht der Welt, im Wald aus Raum und Zeit. Damit werden die Gedichte auch zu Orten der Kontemplation, wenn nicht gar Meditation („auch zuinnerst meldet sich / Grünes zu Wort, so wächst es / jederseits an dir vorbei“, S. 24). Und der Blick richtet sich dabei vor allem darauf, was sonst nicht beachtet wird: auf die Ränder – eine Leistung des Gedichts, die bei Helwig Brunner auf beeindruckende Weise realisiert und noch gesteigert wird zum Lesen des „klein Gedruckten“ im „Lehm“ („Horizonte“, S. 16), zur Suche und zum Fassen nach der Sprache, die der Natur eingeschrieben ist, diese „Schichtung“ (…) „als einzig gültige Schreibweise“ („Lawine“, S. 37) und zur Suche nach dem Menschen, was bisweilen fast in Aphoristik mündet: „lass uns das Wurzeln erlernen, / ein Wäldchen sein zu dritt“ („Baumschule“, S. 27). Durch die „Naturalien“ fließt auch viel Wasser, vom Ozean bis zum Pfützenrand – darin und in der Dichte der Wortkompositionen („ereignisnackt im frischen Schnee“, S. 22) zeigt sich auch eine Nähe zu einem Autor, bei dem das Wasser eine nachgerade leitmotivische Funktion hat: Christoph W. Bauer. Die Welt wird personifiziert oder verdinglicht, von der „Nachdenklichkeit des Ozeans“ (S. 12) bis zur „Materialermüdung des Kontinents“ (S. 15), es wird gekaut, verdaut, gelebt. Interessant ist, dass die Lyrik allgemein gerne Vögel und Steine in sich aufnimmt, was damit zusammenhängen mag, dass sich die Wörter in Gedichten einerseits von der Syntax und dem Fließtext abgehoben, gleichsam wie Vögel schwebend präsentieren, andererseits konzentriert und fest wie Steine gesetzt sind. In „Süßwasser weinen“ ist es nicht anders: Lerchen, Mauersegler, Schwalben, Stieglitze, Singdrosseln sowie Sand, Kies, Lehm prägen das Setting und nehmen die Leserin und den Leser mit auf einen Spaziergang durch eine nur auf den ersten Blick karge, da poetisch akribisch gesetzte und vielschichtig gedeutete Landschaft.
Die Gedichte in den „Musikalien“ sind spürbar mehr durchrhythmisiert und klanglich alliterativer strukturiert und meistens dreht sich’s nun ums Ohr, das „taube“ (S. 45) und das „laute“ (S. 51). Mit „Prim“ (S. 44) beginnt der Sand zu rollen, die Düne zu schwingen und zu singen, wie ein natürlicher Synthesizer, „und wieder an den Ohren herum- / geführt, verirrt ins unvernünftige / Dickicht einer verminderten Prim,“ („Prim“, S. 44). Zudem tritt verstärkt ein dialogisches Element in die Gedichte, ein „Du“, das direkt angesprochen wird. Musik ist hier nicht nur Thema, sondern ein Mittel, menschliche Beziehungen auszuloten, „aber im Solo stehen gelassen, / vergangen wie Hören & Sehen“ („fortgehen“, S. 57). Die Bildebene wird natürlich nicht vergessen und auf spannende Weise mit der Ton- und Klangebene zusammengebracht, eindrucksvoll beispielsweise in „Fermate“ (S. 62, s. Leseprobe). Helwig Brunner ist ein Meister des Simulacrums, der Bild-Bild-Kongruenz, der Bildsetzung und des Sehens von Bildern in Bildern und Schriften in Bildern.
In den „Destillaten“ kommen zunehmend Mund und Zunge ins Spiel. Hier tritt das Element der Sprach-, Schreib- und Poesiereflexion in den Vordergrund, die Hinterfragung scheinbarer Dauerhaftigkeit („Inventur“, S. 90), der Leere einer knallig-prallen Zeitungsseite („Kolportage“, S. 93), der „Zeile in Eile, heiß gelaufen vielleicht“ („Satzzeichen, verortet“, S. 97). Im längsten Gedicht des Bandes, „in Schmuckhaft, Verschub mit Diminutiven“ (S. 96), wird sehr plastisch mit „Episödchen“, „Schimärchen“, „Gewitterchen“, „Messerchen“ und „Kettchen“ die menschliche Kleinheit gezeigt und die „chronische Geschichte“ als „blanke Geologismen“ entlarvt. Und auch in diesen zunehmend sprachkritischen Texten am Schluss des Bandes steckt die Botschaft: Trotzdem Gedicht! Will heißen: Gedicht, um dem allzu glatt und an der Oberfläche rieselnden Sprachsand zu trotzen. Dazu eignen sich die Gedichte von Helwig Brunner auf hervorragende Weise. Sie sind ideale Mittel, „(…) aus der / Kriechspur gefahren grober Texturen,“ („flüstern“, S. 106) zu entkommen, in den grünen Bereich.