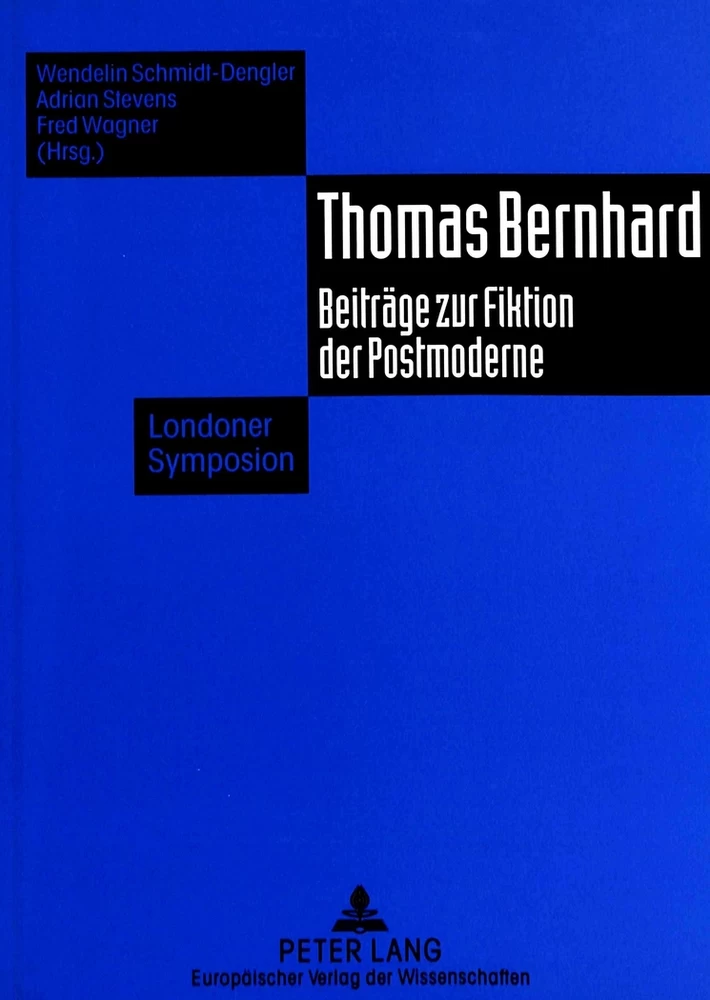Die mit dem Hinweis auf die Postmoderne angerissene vielschichtige Problematik wird allerdings nicht systematisch diskutiert, sondern ergibt sich sozusagen automatisch aus den vor allem von den interpretierenden Beiträgen herangezogenen Referenzautoren. Bemerkenswert sind die Überlegungen von Adrian Stevens über das Schimpfen der Berhard-Figuren als Strategie des künstlerischen Selbstentwurfs. Franz Josef Murau, der Held von „Auslöschung“, avanciert zu einer Personifikation von Richard Rortys Typus des engagierten aber unmethodischen Interpreten, der alles ichbezogen im Lichte seiner Privatinteressen und Neurosen liest. Die befreiende Komik seiner Tiraden etwa gegen Goethe erinnert Stevens an die Theorie Bachtins über den Karneval und das Karnevallachen. Auch Murau versteht Wahrheit im Sinne Nietzsches als „bewegliches Heer von Metaphern“ und die „Auslîschung“ von Wolfsegg stellt der Wahrheit der Besitzung eine neue, karnevalistisch geprägte Wahrheit entgegen. Die bachtinsche Geste „karnevalisiert“ allerdings auch die dem Künstler aufgetragene ästhetische Rechtfertigung des Lebens.
„Auslöschung“, David McLintocks Mühsal schaffende Übersetzungsvorlage, steht in mehreren Beiträgen zentral: Hans Höller liest den Text als „Comédie humaine der österreichischen Geschichte“ und Sabine Kaufmann liefert er die Fundstelle für die gerechtfertigte Suche nach Berührungspunkten zwischen Bernhard und der Frühromantik – eine angesichts der langwierigen „Anschaungsdebatte“ seit dem Bernhardschen Frühwerk und der Vielzahl direkter Referenzen auf romantische Autoren dortselbst nicht so überzeugende Fundstelle. Der von Kaufmann unter anderem angesprochene Ironiebegriff finde – so R. Görner – seinen Kern in den Wiederholungen Bernhards, Wiederholung sei in dessen „Endzeit-Szenarium“ die einzige authentische Erfahrung und Bernhards Werk sei daher die „Anti-Utopie schlechthin“. So können Bernhardsche Einzeltexte gelesen werden, wer allerdings die „Entwicklung“ der Bernhardschen Szenarien und der sie bevölkernden Figuren von Weng aus „Frost“ bis zu Muraus Rom verfolgt, sieht, daß die „Wiederholungen“ einem Prinzip der allmählichen Variation unterworfen sind, das am Ende ein durchaus hoffnungsfrohes Ergebnis zeitigt.
Das prinzipielle Mißverhältnis zwischen dem Handeln der Bernhardschen Protagonisten und ihrer Rede und die Vieldeutigkeit derselben, die Berhards sucherisch-spielenden Umgang mit der Ambivalenz abbildet, gibt den Interpreten scheinbar unbegrenzte Argumentationsfreiheit. Der Postmoderne ist diese Lizenz nicht fremd, doch damit die Bernhard-Lektüre nicht in der Beliebigkeit unzähliger punktueller Analogien versinkt, sei an Schmidt-Denglers den Band abschließendes energisches Plädoyer für eine Rückkehr zum Text erinnert.