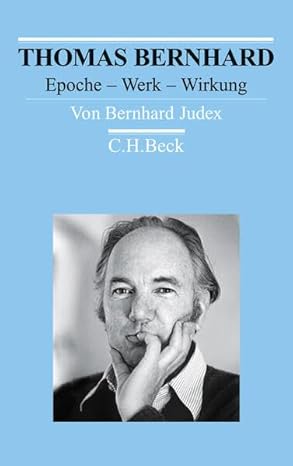Judex konzentriert sich bei seinem Vorhaben bewusst auf „einzelne werk- und wirkungsgeschichtlich relevante Texte“ (S. 10) und gliedert das Buch in fünf große Abschnitte, die der Biografie und dem literaturhistorischen Kontext, der Entwicklung vom Lyriker zum Erzähler und „Geschichtenzerstörer“, dem Dramatiker, den autobiografischen Erzählungen und den späten Texten „Auslöschung“ und „Heldenplatz“ gewidmet sind. Dazu kommen eine sehr umfangreiche Bibliografie zur Primär- und Sekundärliteratur sowie von weiteren zitierten Werken, eine detaillierte Zeittafel und ein Namen- und Werkregister.
Die einzelnen Abschnitte sind gleichbleibend aufgebaut: nach kurz gehaltenen „einführenden Informationen“ folgen zu den jeweiligen Unterabschnitten (z.B. zu Bernhards Leben, zum literaturgeschichtlichen und historischen Kontext oder zu einem Werk) „Grundlageninformationen“ (Hinweise auf relevante Texte und Materialien und annotierte Bibliografie zur Sekundärliteratur) sowie eine kurze Skizze von „Voraussetzungen, Entstehung und Wirkung“ des jeweiligen Werkes. Erst dann folgen Textanalyse und Erörterung zentraler Motive und spezifischer Fragestellungen. Beinahe die Hälfte des Buches besteht also aus bibliografischen Hinweisen, wobei besonders die annotierte Bibliografie zur Sekundärliteratur innerhalb der einzelnen Abschnitte trotz der notwendig knapp gehaltenen Angaben eine sehr nützliche und hilfreiche Orientierungshilfe bietet.
Verständlicherweise kommt auch dieses Arbeitsbuch nicht ohne einen biografischen Einstieg aus. Der Autor verschränkt dabei zwar lebensgeschichtliche Fakten und deren Manifestationen im Werk, fokussiert jedoch die Biografie interpretierend schon durch den übergeordenten Titel des Abschnitts als „Subjekt des Textbegehrens“ und akzentuiert drei große Phasen im Leben Thomas Bernhards: Kindheit und Jugend als ‚Erziehungsverbrechen’, die schriftstellerische Tätigkeit seit dem Beginn der fünfziger Jahre als ‚Unglück im Ankommen’ und die lange Phase der öffentlichen Wahrnehmung und Anerkennung seit den siebziger Jahren als „Lust an der Provokation“ des erfolreichen ‚Altersnarren’, sein Testament als „letztes Kunstwerk“ (Thuswaldner) und „posthume literarische Emigration“ (Fabjan) eingeschlossen. Die Abkehr vom Aufführungs- und Veröffentlichungsverbot in Österreich durch die Gründung der Privatstiftung, die Arbeit des Thomas-Bernhard-Archivs, die neueinsetzende Rezeption infolge der Neuinszenierungen wird zu Recht als Hinweis auf die endgültige Kanonisierung von Thomas Bernhard gesehen.
Thomas Bernhard wird in diesem ersten Abschnitt nicht nur auf das schreibende Subjekt reduziert, sondern in den zeit- und literaturgeschichtlichen Horizont der 2. Republik eingeordnet, in die restaurativen 1950er und frühen 1960er Jahre, in die darauf folgende Zäsur mit dem Aufbrechen der Avantgarde. Hieraus nährt sich Berhards kritische Distanz und Wut gegenüber der politischen Realität, sein Bemühen, sich in einem polarisierten Literaturbetrieb von epigonalem, traditionalistischem Schreiben und der Rezeption von Moderne und Avantgarde zu etablieren und zu behaupten, und in der Folge seine Skepsis gegenüber Sprache und der erzählten Wirklichkeit, die ihn zum ‚Geschichtenzerstörer’ werden lässt.
In Hinblick auf die Absicht, Werk und Wirkung darzustellen, ist es daher berechtigt, angesichts der sehr reduzierten Auswahl der besprochenen Texte, auch die Lyrik eingehend zu besprechen. Sie wird nicht mehr als bloß vorbereitende, dann abgeschlossene Schaffensphase dargestellt, sondern als „experimentelle[s] Ausprobieren und Nebeneinander verschiedener Formen“ (S.38). Der trotz aller Knappheit doch sehr differenzierte Überblick über Motive und poetische Verfahren verdeutlicht, dass es zu kurz greift, Bernhards Lyrik als Protophase seines Schaffens oder als „bloße Bewältigung persönlicher Leidenserfahrungen“ (S. 45) zu begreifen.
Dass in einem Arbeitsbuch auf eine Auseinandersetzung mit Bernhards erstem Roman „Frost“ oder mit der „Autobiografie“ – vor allem unter poetologischen Aspekten – nicht verzichtet werden kann, ist mehr als nachvollziehbar. Erfreulich ist jedoch, dass ein von der Literaturwissenschaft in den letzten Jahren wenig wahrgenommenes Werk Beachtung findet – ein Blick in die Bibliografie bestätigt diese Vermutung –, nämlich der zeitgleich mit „Die Ursache“ erschienene Roman „Korrektur“, dessen Rezeption zwischen vollkommen gescheitert und unüberbietbar osziliert und der als postmodernistischer Roman, als ‚offenes Kunstwerk’ (Eco) vorgestellt wird, der „bewusst den Erwartungshorizont des Lesers [unterläuft].“ (S. 76)
Dass von 18 abendfüllenden Theaterstücken im Kapitel zum Dramatiker Thomas Bernhard nur zwei ausführlicher vorgestellt werden, mag man bedauern. Die Auswahl ergibt sich jedoch aus der grundlegenden Typologisierung der Bernhardschen Dramen von Künstlerstücken und Beziehungsdramen (Familiengeschichten), wobei die ausgewählten Stücke („Der Ignorant und der Wahnsinnnige“ und „Der Theatermacher“) die Vorläufigkeit solcher Typologien unterstreicht.
Mit „Verstörung“ und „Heldenplatz“ ist der letzte Abschnitt Bernhards ‚Lebensthema’ gewidmet, dem Umgang mit dem belasteten Erbe der Geschichte. Beide Texte werden im Kontext der Entwicklung von Thomas Bernhards poetologischen Konzepten analysiert und in der Zusammenschau der Interpretationsansätze als Bernhards lebenslängliche Auseinandersetzung mit dem „österreichischen Ungeist“ dargelegt, wobei „Heldenplatz“ als „performative Auseinandersetzung mit dem Mechanismus der Verdrängung, dem lückenhaften Diskurs über die NS-Zeit und den Krieg“ (S. 145) aus der Tagesaktualität der Uraufführung herausgehoben wird.
Der letzte Abschnitt bietet sozusagen eine Summe der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Werk Thomas Bernhards, doch wäre eine abschließende Zusammenfassung wünschenswert, in der beispielsweise das Verhältnis von Figur und Autor diskutiert werden könnte, auch wenn Judex erfreulicherweise auf biografistische Spekulationen verzichtet. Dafür bietet er aus einer beeindruckend breiten und differenzierten Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur überzeugende Deutungsansätze. Leider erschwert diese umfangreiche und akribische Rezeption der Sekundärliteratur jedoch die Lesbarkeit des Buches, weil Judex sich oft zuwenig von ihr löst. Indem er diese zwar seriös zitiert, produziert er aber wiederholt Sätze mit gehäuften Verweisen, was Leserinnen und Leser ohne größere Erfahrung mit wissenschaftlicher Literatur wahrscheinlich einschüchtert. Doch kann dieses Manko den hohen Wert dieses Arbeitsbuches nicht schmälern.