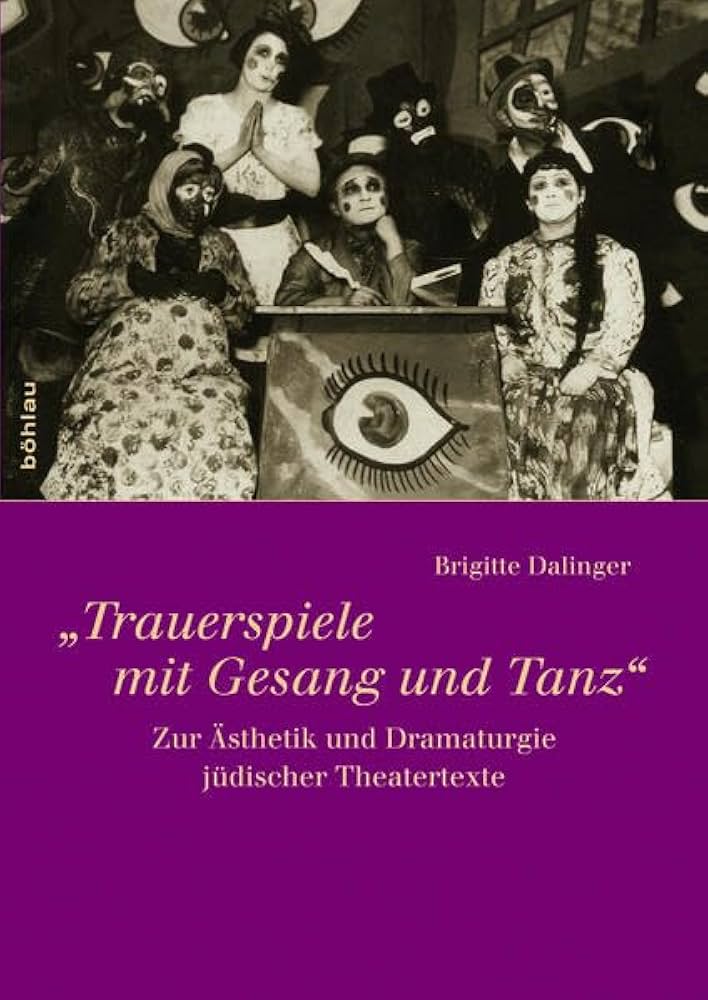„Im Zentrum dieser Arbeit stehen jüdische Theatertexte, die von etwa 1890 bis 1938 in Wien aufgeführt und/oder geschrieben wurden.“ Im Zentrum stehen dabei deutsche und – was besonders erfreulich ist – auch die „oft diffamierten“ jiddischen Theatertexte, an die folgende „Fragen“ gestellt werden: „Warum können sie als ‚jüdische’ Dramen bezeichnet werden? Welche Themen und Motive werden aufgegriffen, welche Milieus und Personen werden gezeigt? Welche dramatischen Formen, welche dramaturgischen und ästhetischen Mittel kommen beim Schreiben/Inszenieren zum Einsatz?“ (S. 13)
Als ihre beiden vorrangigen Ziele nennt die Autorin:
„1. Die jüdischen Dramen wieder ins Bewusstsein zu bringen, […] zu belegen, dass es diese Theaterstücke gibt […]. Daher enthält die Dramenbibliographie [S. 341-352] nicht nur Angaben zu den Texten […], sondern auch alle [der Autorin] bekannten Übersetzungen der Dramen.“ Das macht das Buch auf jeden Fall zumindest für alle „Theatermacher“ interessant und inspirierend.
„2. [Die Arbeit soll] als Basis einer neuen Lesung und Sichtung jüdischer Dramatik, aus alter Zeit und von heute, dienen.“ (S. 17)
Der aktuelle Forschungsstand wird etwa aufgezeigt im Hinblick auf das, was „jüdische“ Dramatik ausmacht (und zwar vor allem Sprache und Inhalt), was anhand der jiddischen Sprache und Kultur grundlegend dargestellt wird. Dabei zeigt Brigitte Dalinger eindrucksvoll, wie die „Eigenständigkeit“ in intensiver Auseinandersetzung mit „nicht-jüdischer“ Dramatik erlangt werden konnte, und das ist durchaus nicht als Widerspruch zu sehen. „Nichtjüdische Dramatik war also die wesentliche Grundlage der jiddischen Dramen, und das nicht nur in stofflicher, sondern auch in dramaturgischer Hinsicht. Die meisten jiddischen Singspiele, Operetten, Komödien, Possen und Revuen, aber auch Tragödien sind aufgebaut wie ihre anderssprachigen Äquivalente.“ (S. 61) Und Dalinger analysiert immer wieder an konkreten Beispielen solche Prozesse kreativer Aneignung etwa im Zusammenhang mit den Einflüssen von Ibsen, Strindberg, Shakespeare und vieler anderer nicht-jüdischer Vorbilder.
Den Hauptteil der Arbeit bilden dann „zentrale Themenbereiche der jüdischen Theaterstücke auf Wiener Bühnen“ wie „Liebe und Partnerwahl, Ehe und Familie“ (einschließlich der Thematisierung der „Liebe und Ehe zwischen Juden und Nichtjuden“); „Antisemitismus“ (etwa Stücke von Theodor Herzl (Im Speisewagen), Max Nordau (Doktor Kohn), Arnold Zweig (Die Sendung Samaels) oder Arthur Schnitzler (Professor Bernhardi); „Geschichten und Personen aus der Zeit vor der Diaspora“, damit ist vor allem die jüdisch-religiöse Tradition der Bibel, die Geschichte der Juden vor der Diaspora, gemeint. Einer genauen Analyse unterzogen werden dabei etwa eindrucksvoll die Stücke Akejdeß Jizchok (Die Opferung/Bindung Isaaks) von Abraham Goldfaden (1897), Der ewige Jude von David Pinski (1906), in dem der Ahasver-Mythos verarbeitet wird, Jaákobs Traum (1918) von Richard Beer-Hofmann und Jeremias (1917) von Stefan Zweig. Und schließlich geht es noch um „Mythen und Legenden“ wie den Golem-Mythos, der in verschiedenen Golem-Dramen (beispielsweise in dem vielschichtigen Weltstück Der Gojlem von H. Leivick) ausgedeutet und aktualisiert wurde.
Die Autorin beschreibt als Grund-Lage all dieser Stücke eine durchaus moderne, existenzialistische Erfahrung, die im Judentum besonders reflektiert wahrgenommen wurde. „Der Zerfall der traditionellen Welt machte das Entstehen der jüdischen Dramatik erst möglich, wie auch das Entstehen eines säkularen und professionellen und jüdischen Theaters erst nach dem Aufbrechen der geschlossenen jüdischen Welt möglich geworden war. Dieser Zerfall, der Wandel des jüdischen Lebens von der Tradition in die Moderne, der eine Krise und Neubestimmung der jüdischen Identität bedingte und erforderte, ist zugleich die allen jüdischen Dramen inhärente Basis, wenn auch nicht ausgeformte Thematik.“ (S. 338)
Abgesehen davon, dass Brigitte Daligners Buch in die Handbibliothek eines jeden Literaturhistorikers, Theaterwissenschaftlers oder sonst professionell mit dem Theater oder mit jüdischen Studien Beschäftigten gehört, ist es weit über diese primär angesprochenen Kreise hinaus von Interesse, weil es mit Themenbereichen klassisch-jüdischen Theaters und darüber hinaus mit einer Vielfalt an historischen und kulturellen/religiösen/mystisch-mythologischen Kontexten bekannt macht.
Dass die Autorin dabei als eine methodologische Voraussetzung anführt, dass „nichts vorausgesetzt werden“ dürfe (S. 30), ist bei diesem Thema durchaus angebracht – und mach das Buch gut lesbar.