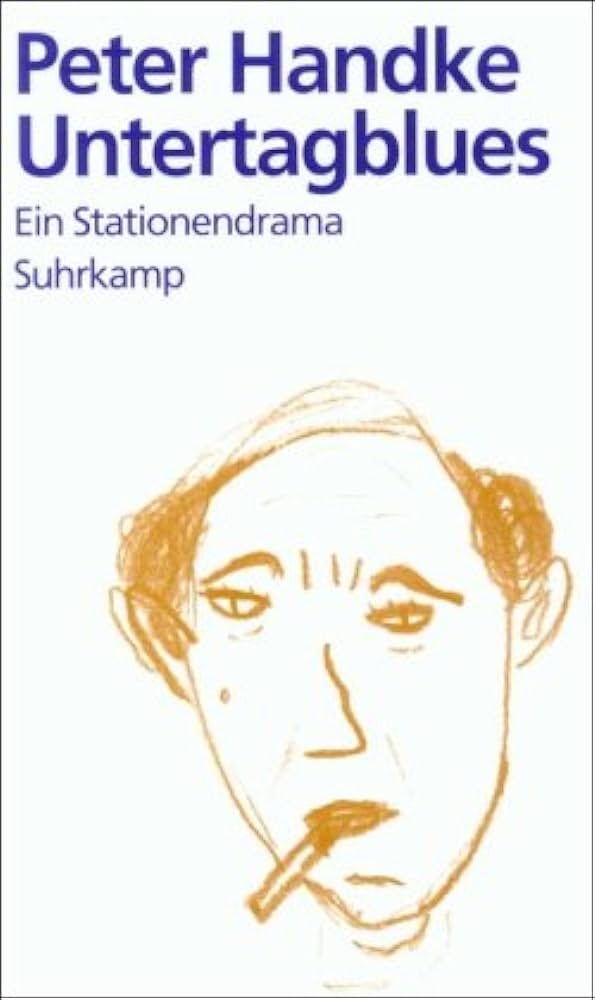Der Titel verweist sichtlich auf Bob Dylans surreale Welt-und-Zeit-Inventur – „Subterranean Homesick Blues“, einen Rap avant la lettre – der nicht nur den Ton vorgibt, sondern auch die Struktur des Stücks mitbestimmt. Denn bezeichnenderweise bleibt das Heimweh als Mitte des Titels ausgespart; die nicht nur rückwärtsgewandte Sehnsucht nach Zugehörigkeit bleibt ungesagt. Zur bluesigen Sprache – bald zornig, bald elegisch – kommt hingegen alles, was dem Mann auf der Zunge brennt; seine anschwellende Wut macht sich immer vehementer Luft. Die Schimpfkanonade richtet sich diesmal allerdings nicht an das Publikum im Saal, die zu widerspruchslosem Zuhören verdammten Geschmähten sind die stummen zu- und aussteigenden Mitreisenden. Der „Untertagblues“ ist ein Sprechstück, ganz in der Tradition der medien- und diskurskritischen Anfänge Handkes. Doch zum Unterschied zur seinerzeit geübten reflektierten Distanz weiß er sich nun mit dem beschimpften Publikum eins, bekennt sich geradeheraus zu ihm: „mit den Gesichtern zu uns Zuschauern“ (S. 10). Daher behält, wer sich an Raunzer von Raimund bis Bernhard erinnert fühlt, nur eine Zeitlang Recht. Der Wortreichtum weicht das Gesagte nach und nach gehörig auf, die Insistenz unterhöhlt jeder vorschnelle Gewissheit.
Der manische Dauerredner redet seinen Mitreisenden in der U-Bahn zwar die Ohren voll und wirft ihnen Weisheiten, Verbalinjurien und viel Unsinn an den Kopf, doch die auf einzelne Personen gemünzten Bemerkungen, räumt Handke in den Regieanweisungen freimütig ein, könnten durchaus auch unzutreffend sein: „Bemerkung – welche auf den Adressaten gar nicht zutreffen muß …“ (S. 49), „(die meisten seiner Evokationen treffen auf die Angeredeten gar nicht zu?)“ (S. 55) Wort und Tat klaffen augenfällig auseinander. Die Sympathie für den Wilden Mann, soweit überhaupt vorhanden, wird auf die Probe gestellt. Was dem Autor von der Boulevard-Presse als persönliche Attacken auf einen hohen geistlichen Würdenträger (S. 36f.), einen „Universalpreisträger“, das „Mitglied des Rates der Weltweisen“ (S. 38f.) und einen „Hohen Kommissar“ (S. 40ff.), die in der Untergrundbahn anzutreffen eigentlich überraschen sollte, in den Mund gelegt wurde, ist ein klassischer Fall von Figurenrede. Doch nicht um die Welt- und Zeitläufte geht es eigentlich; der Fluchtpunkt der öffentlichen Rede ist im Innersten, im Intimen.
Wie schon unlängst in der großen Liebesgeschichte „Der Bildverlust“ – im übrigen der ersten, die Handke über den gespitzten Stift gekommen ist – ist das Gegenüber des Protagonisten eine sanft-starke, eine WILDE FRAU, die seinem schier endlosen Schwall mit wenigen Worten Paroli zu bieten im Stande ist. Dabei tut sie es ihm gleich, macht es um keinen Deut anders: „Sie wiederholt einige seiner vorherigen Schmähungen. Das Gesagte trifft nicht zu?“ (S. 76), ist also weniger Gegenentwurf als Seinesgleichen? – An der vorletzten Station ist sie „in Richter- oder Rächerrobe“ zugestiegen, und plötzlich findet sich der Ankläger auf der Anklagebank. Sie ist sich zwar ihres Rollenverhaltens bewusst, doch nicht des größeren Gewichts ihrer Worte: „du Monolog du. Und in Wahrheit müßte meine Rolle hier dreimal so lang sein wie die deine.“ (S. 77) Gewieft sucht er jedoch „Zuflucht bei ihr, der Vollstreckerin. Und was bleibt ihr übrig, als die Vollstreckung vorderhand einzustellen?“ (S. 77): So werden sie nach dem Sündenfall neu zu Eva und Adam und ihre Unterwelt zum Paradies; oder verlassen sie als Eurydike und Orpheus den Hades: „das letzte Streckenstück ist oberirdisch“ (S. 77). Am vorgeblichen Endbahnhof, der als einziger vorerst namenlos bleibt, leuchtet schließlich ein Dreifach-Name auf, der auf das Flussgleichnis des Heraklit verweist: Auch die letzte Haltestelle ist nur eine Übergangsstation. Das Paar schweigt; ebenso zwingend wie befreiend gehört das letzte Wort dem Glücksmantra des Stationslautsprechers.
Durch vertiefende Wiederholung öffnet sich der Weg ins Andere. Nicht nur zum Lichte drängt die Handlung, auch zum Klang, beginnt das Stück denn auch „lautlos und zugleich deutlich rhythmisch“ (S. 9), fährt es bald fort „in einem Tonfall von Heiterkeit […], in einem klaren Singsang“ (S. 13), wird endlich vernehmlicher und eindrücklicher, des Wilden Mannes „Blues [geht über] in eine Art von Rock“ (S. 66), und mehr noch, über das Instrumentale hinaus: „fast kommt der WILDE MANN ins Singen.“ (S. 67) – und schließlich könnte das Ziel momenthaft sogar erreicht sein „Er singt und musiziert momentlang tatsächlich, Harmonika?“ (S. 68) Dabei treibt ihn, so einfach ist das, der Abscheu vor dem Hässlichen und die Sehnsucht nach dem Schönen. Und es will scheinen, als gehe der WILDE MANN nur durch die Hölle des Hässlichen, um sich, durch das Fegefeuer des Hasses geläutert, schließlich in erneuerter Unschuld dem Schönen zuzuwenden, denn er glaubt „nur dem Schönen, leider“. (S. 25) Diese Schönheit weitet den Horizont, versöhnt und verbindet: „Wenn es wo schön ist, wird es dort, wo es schön ist, überall.“ (S. 68) Das Schönfärben wird zum Gegenteil von Lüge. Denn nicht nur die Schönheit liegt im Auge des Betrachters: „Allerhäßlichster, der du alles verhäßlichst mit deinem häßlichen Blick.“ (S. 75) Wider die vorschnelle Eindeutigkeit des vorgeblichen Wissens setzt Handke die Schönheit der Ahnung: „Wie schön unwissend waren wir zwei einmal, du und ich. Wie liebenswert begriffsstutzig unterm Milchstand. Und jetzt: du häßlicher Kenner.“ (S. 43) Nicht ahnungslos, aber auch nicht stumm und starr von Vorahnung kann man sich also auf das Abenteuer einlassen, im Unbekannten überraschend das Schöne zu entdecken: „He, am schönsten war s, wenn man nicht wusste, wohin man führe; […] wie s dort aussehe; was einen dort erwartete“ (S. 78).
Unvermittelt begegnet uns auch der Text; klappentextlos, aus allen Kontexten gelöst. Den Umschlag ziert eine Zeichnung von Kinderhand, die wohl den WILDEN MANN vorstellt. Es ist sichtlich kein Abbild des Verfassers. Vielnamig sind die Orte, nicht austauschbar, aber auf irritierende Weise verwechselbar, mit und an nichts festzumachen, genauso wie der Protagonist. Ist der WILDE MANN nun Volksredner oder Volksfeind – oder beides? Hätte der Autor so etwas wie Selbstverteidigung nötig, ließe sich der Blues im Übrigen auch als ironische Überzeichnung der von den Medien erzeugten Handke-Karikatur verstehen. Die Schwebe, geübt schon in „Der Bildverlust“, macht das Zorngewebe luftig und verleiht ihm eine eigentümliche Anmut. Selbst dort, wo die inhaltliche Gefolgschaft längst aufgekündigt ist, wirkt der Sog der sinnlichen Bilder in einer frisch-frech-unfrommen Sprache fort: bissig, aber nicht verbissen; verliebt in die Sprache und nicht – wie Handke so gerne vorgeworfen – in sich selbst: vieldeutig und klar zugleich.