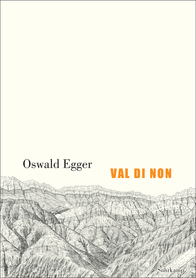Auffällig ist die Größe des Buches und seine Aufmachung selbst, was auf einen Bildband schließen ließe. Doch das Hauptgewicht liegt auf den Texten. Auf Details fokussierte und in schwarz-weiß gehaltene Zeichnungen von Naturdingen („Ich glaubte, sie alle nacheinander abzeichnen zu müssen, ….“ S. 46), die ungeachtet ihrer Genauigkeit nicht wirklich erkennbar und daher wieder abstrakt sind, werden wie Skizzen aus alten Lehrtafeln oder Lehrbüchern ausgebreitet und dann von Gedichten interpretiert („Wie meine beiden / reifen zwei /schwarzen / Johannisbeeraugen.“ S. 158).
Ein formal strenger Aufbau bestimmt das Werk: Textblöcke, die sich auf der unteren Hälfte der Seiten befinden, scheiden sich von darüber wie Wolken herumschwebenden oder hängenden klassischeren und kursiv gesetzten Gedichttexten, die die Skizzen beschreiben und oft antiaphoristisch anmuten („Diese hier zweimal / mit und einmal / gegen die Sonne / gesegnete Umgebung.“ S. 16). Die im Blocksatz gehaltenen „Bodentexte“ bestehen aus 13 Zeilen, je 13 Bodentexte gibt es pro Kapitel und der Gesamtband beinhaltet 13 Kapitel. Doch hier gibt es Abweichungen, denn ein unvollständiges – ein vierzehntes Kapitel – wird am Ende drangehängt. Dieses letzte Kapitel suggeriert, dass das Buch nach hinten offen ist, „auslaufen“ soll. Eine ganze und vollständig beschriebene Blocksatz-Seite am absoluten Ende schiebt diesem Unabgeschlossenen jedoch den Riegel vor. Und dennoch: Auf dieser letzten scharf abschließenden Seite wiederum ist der letzte Satz mit einem Bindestrich offen gelassen. Was ist es nun: offen oder zu? Ja was ist ein Tal: Ist es offen oder zu?
Eine fast unmerkliche Abweichung kennzeichnet auch das erste Kapitel: Es besteht aus nur 12 Texten. Es wird also von sich aus mit der Form gebrochen, aber nur subtil, sanft beinah, als gehörte das genau so gemacht, denn Anfang und Ende sollen weniger streng gehalten sein, wie eine Landschaft, die sich nach und nach als solche zeigt und nach und nach wieder auflöst.
Neue Abschnitte werden von doppelseitigen Bildern markiert, es eröffnet hernach – im immer gleichen Aufbau – ein erzählenderer und kursivgesetzter Text auf der ersten linken Seite. Und auch die Texte selbst sind bildhaft: Die 13-zeiligen Texte am unteren Ende der Seite machen sich als Boden aus, wie ein Tragendes, im Bergmassiv als Basis eines Berges, was dann die Gedichte nach oben hebt und sie stützt und schützt, ihnen Sicherheit bietet. Über diesen blockartigen Texten schweben also die Gedichte, leicht und frei, und auch die Zeichnungen, auf/oberhalb dieser textlichen Basis.
Wie bereits ausgeführt, richten sich das erste und das letzte Kapitel gegen die vorgegebene Form. Doch: Warum sind genau diese Kapitel mit Weiblichkeit assoziiert? Warum sind dies die unvollständigen Abschnitte? Ist das im Nonstal so? Oder ist es genau das Gegenteilige, das widerständige und gegen die Norm strebende Weibliche, das hervorgehoben werden soll?
Und dann auf S. 204 vielleicht eine Auflösung, wo es heißt: „Novella (das alte Wort für Fut)“. Das Wort Novella wird unzählige Male im Buch genannt, jedoch als Name eines Gebirgsflusses (etwa S. 22, S. 25, S. 49, S. 157, S. 166). In der absoluten Mitte der Textsammlung gibt es das „Novellenknäuel der Verkolkung“ (S. 104/105) – Novella also doch nicht als Fluss, sondern als Hinweis auf das weibliche Geschlecht? Und verbunden mit dem ersten Kapitel: Meint es die Mutter, also die Geburt? Meint es die Rückkehr dazu, zum Ursprung (immerhin ist das Nonstal der Geburtsort des Autors)? Meint es den Lebensrhythmus, einen Lebenszyklus vielleicht? Oder ist es einfach nur sexistisch und bildet (in diesen zigfach auch wie Vaginen gezeichneten Novellas) die Lust des Autors ab? Diese Frage lässt sich womöglich nicht werkimmanent klären – oder überhauptnicht.
Klang und Rhythmus dominieren gegenüber dem Inhalt: „Zerschluchtet muschelige Rutschzungen zwischen Gabelungen gegrabene Bruchhangflanken, in die zwei Strömungsriedel eingeschnitten sind, mit oft springlebendigen Koboldspornen kinderten walmig atmend in Runsen nach unten in den Tobel, und schnauften auflastend schwer über dem Tal. Zwischen Tobel und Joch Löcherkarren und schüsselig überschliffene Kolke, und wie dann diese Wut den Lärm begrub.“ (S. 31)
Der geringere Stellenwert des Inhalts zeigt sich auch in den Zeitformen, die innerhalb eines Satzes verkehrt werden, wie: „Aber die Blätter welken sich tot und verdorrten, …“ (S. 33), oder in der Aufzählung der Monate „Juli, September, August“ (S. 7 und S. 30). Auch die Jahreszeit ist nebensächlich und oft nicht klar.
Und dennoch muss die Frage gestellt werden: Worum geht es? Um das Nonstal und um Natur – aber NUR um Natur: ein extrem gerichteter Blick auf alles Nichtkünstliche wie jener eines Forschers, eines Mineralogen, Gesteinskundlers, Biologen oder was auch immer, nur mit einer unglaublich großen Sprache, die dieses „Kleine“, das „Natürliche“ wieder aufmacht, es vergrößert, beinah entgrenzt, es öffnet, aber auch gegenüber dem biedermeierlichen Blick einerseits und dem Blut- und Boden-ideologischen Naturzugang, dem Heimattümelnden andererseits, abgrenzt.
Das tut Egger in einer eigenen Sprache, wie einer Fachsprache, und oft stellt sich die Frage: Gibt es diese Wörter überhaupt? Sind es Neologismen, Fachwörter aus Biologie, Zoologie oder Geologie, oder Dialektales (ein einziger Text – auf S. 39 – ist gänzlich im Dialekt gehalten)? Aber eigentlich ist es egal – es zählt/rangiert das Wie vor dem Was, als Gesamtklang, als Fließen aus Rhythmus und gleichmäßigem Tönen, stetig wie jenes einer Schreibmaschine, worüber die kürzeren Gedichte „drüberschweben“ als Gipfel oder Wolken, und die – was ebenso der Form geschuldet ist – zwar aus dem Selben bestehen, aber nur durch diese Zuspitzung und die Zeilensprünge etwas ganz anderes sind: luftig, durchschaubar, einfach. Der Autor führt hier vor, was mit ein- und demselben Material nur aufgrund von Syntax möglich ist.