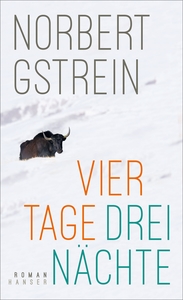Da ist der Vater im Bergdorf, der ‚Pensioner‘, wie sie ihn im Ort mit Aliasnamen nennen, eine eigentlich komische Figur: Der zum Hotelier aufgestiegene, macht- und geldgierige Tiroler Sturschädel mit seinem ewigen ‚Ich versteh die Welt nicht mehr‘ angesichts seiner Kinder, die sich gegen die väterliche und die unverbrüchliche Tiroler Weltordnung auflehnen, manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist die Welt von Karl Schönherr, aus dessen Tiroler Volksstücken (zum Beispiel Der Weibsteufel, 1914) ins 21. Jahrhundert konserviert. Weil sich Tirol nicht ändert. Immer noch in ganz Tirol und in allen Romanen Gstreins Schnee, Schitourismus, rücksichtslose Ausbeutung der Ressourcen – und Widerstand dagegen. Bisher waren es meistens Brüder, von denen wenigstens einer gegen den Vater aufsteht und weggeht, nach Deutschland in eine Stadtwüste oder besser in die größere Wildnis, die Amerika zu bieten hat. Auch das war in Tirol schon immer genau so, es einzufangen und wieder und wieder zu erzählen versteht keiner besser als Norbert Gstrein. Diesmal ist es aber eine Tochter bzw. Halbschwester, die sich auflehnt, und sie ist gar keine Tirolerin, sondern eine Deutsche, weil der Vater sie mit einer Urlauberin gezeugt hat. Elias und Ines verbringen als Kinder und Jugendliche die Ferien miteinander, sie wissen nicht, dass sie Geschwister sind, womit das Inzestmodell funktioniert. Ines (vielleicht der moderne Weibsteufel) liebt die Literatur, sie treibt mit ihr Wissenschaft, sie ist besessen, exzentrisch, narzisstisch, Männer zieht sie an, um sie dann wegzuwerfen. Elias, ihr unterlegen, räumt für sie die Kollatoralschäden auf, indem er sich der von der Schwester ausgemusterten Liebhaber annimmt. Sein aktueller Freund Carl ist von der Mutter her Deutscher, vom Vater her Afroamerikaner. Weihnachten 2020 rückt heran, der Vater plant unter Umgehung der Pandemiegesetze einen illegalen Saisonopener unter dem Motto Vier Tage, drei Nächte in seinem Hotel. Elias sucht bei Ines in Berlin Zuflucht, um nicht aushelfen zu müssen. Carl kommt zu Besuch und Ulrich, ein eifersüchtiger Liebhaber, stalkt Ines, diese beginnt sich derweil für Carl zu interessieren. Das ist die Ausgangslage, das Begehren braucht den Dritten, dieser Roman des Begehrens ist ein Gitter aus Dreiecken.
Meisterhaft erzählt
Der Roman zieht einen unwiderruflich in ein mit enormer Intensität erzähltes Geschehen. Man kann sich nicht wehren, man fühlt sich schutzlos ausgeliefert. Das liegt vielleicht daran, dass diese Art des inzestuösen Begehrens in uns allen steckt und wir alle die aus der Herkunftsfamilie ererbten Konflikte ein Leben lang mit uns tragen. Jede Leserin kann sich mit Ines identifizieren, möchte wie sie die lästig gewordenen Liebhaber von einem kleinen Bruder abservieren lassen, der sie auch noch abgöttisch liebt, aber bloß mit seinem Herzen, nicht mit seinem Fortpflanzungsorgan, an den sie sich darum nächtens kuscheln kann, weil es nur der Bruder ist und weil er dazu auch noch schwul ist. Und wieviele Leser gibt es, die nicht insgeheim oder offen gegen den Vater revolutieren, gegen dessen Leistungsgehabe! Vielleicht spürt mancher sogar, wenn er ehrlich ist, in sich selbst den Wunsch, es Elias gleich zu tun: die Vaterrolle zu verweigern. Darum geht es Elias. Sein Versagen im Studium, bei der Pilotenausbildung (in Folge einer unerklärlichen Flugangst), das Scheitern als Frauenverführer, alles deutet darauf hin, auch der Beruf des Stewards statt des Piloten und schließlich die sexuelle Neu-Orientierung. Die emotionalisierende Erzählweise des Romans mit den plastischen Bildern und mit Dialogen, die exakt wie Kleidungsstücke sitzen, erzeugt eine Spannung, wie wir sie vom Hollywood-Kino gewohnt sind. Es knistert ständig, aber es gibt keine einzige Beschreibung sexuellen Geschehens, die erotische Ladung treibt das Geschehen auf Eskalationen zu, doch die entladen sich in Komik, wie in der Szene, in der Ines ihren abgehalfterten Liebhaber am Weihnachtstag im Kreis seiner Familie ohrfeigt, oder in der Schlussszene des Romans, wo die Spannung in einem schönen letzten Bild in sich zusammenfällt wie ein Spiel mit Seifenblasen. Nicht nur Elias‘ Stimme ist zu hören, nicht bloß Elias‘ Sicht zu lesen, Gstrein bedient sich aus der Trickkiste des Erzählens, mit kleinen Binnenerzählungen aller Dreiecks-Protagonisten arrangiert er Mehrstimmigkeit.
Kein Nobelpreis
Die Psyche der Figuren eines Romans mit solcher Intensität darzustellen, das schaffte in der österreichischen Literatur einst Arthur Schnitzler (zum Beispiel mit Der Weg ins Freie, 1908). In meiner Jugend war es Johannes Mario Simmel (zum Beispiel mit Liebe ist nur ein Wort, 1963), der ähnlich wie früher Schnitzler und jetzt Gstrein mit einem Mix aus leidenschaftlichen Privataffären und ‚current affairs‘ das Leserpublikum emotionalisierte und zur Identifikation zwang. So zu schreiben lohnt sich – und ich schreibe ein gefährliches Wort gelassen hin: – für die ’normalen Leser‘, für ein Massenpublikum also, das – noch gefährlicher: – ’naiv‘ genug ist, sich hineinziehen zu lassen. Ein deutsch schreibender Autor kann mit einem solchen Programm nicht den Nobelpreis gewinnen, ein Österreicher nicht einmal den österreichischen Staatspreis. Norbert Gstrein weiß das, es wurmt ihn, und es wurmt ihn, dass es ihn wurmt. Vier Tage, drei Nächte kann auch als Meta-Erzählung zu dem Diskurs gelesen werden, was ein Wort, was die Sprache, was eine Geschichte, was ein Roman darf/soll/muss. In den Gesprächen zwischen Elias und Ines geht es sehr häufig um Literatur, Ines entschließt sich, den Beruf der Universitätsgermanistin an den Nagel zu hängen und einen Roman zu schreiben. „Für eine Literaturwissenschaftlerin hatte Ines nur einen sehr schwachen Glauben an die Zukunft des Romans, sie sagte, das Genre verbrenne sich selbst und produziere in seinem Niedergang ein paar Glanzlichter, bevor alles in den letzten Strohfeuern aufgehe, […]“ (S. 311). Zur Wiedergabe dieser bemerkenswerten Ansicht fügt sich eine weitere Passage mit einer verdeckten Spitze gegen den amtierenden österreichischen Literaturnobelpreisträger; sie ist in der in extenso zu lesen, weil sie die für den ganzen Roman wichtige Episode der ersten Begegnung der Geschwister schildert; interessant ist genau die Form, die Perspektive der Erzählung. Der Satz über den Nobelpreisträger darin aber lautet: „Sie hatte die Wendung von einem Schriftsteller, der anderen Beschreibungsschwäche vorgeworfen hatte und in Wirklichkeit selbst ein bisschen beschreibungsschwach oder zumindest beschreibungsfaul war […]“ (S. 115). Ich plädiere für eine offene Diskussion der Frage, ob ein Roman emotionalisieren darf oder langweilig sein muss. Selbst bekenne ich mich dazu, die Romane von Norbert Gstrein mit zunehmender, diesen letzten mit ungeteiler Begeisterung gelesen zu haben und die Romane von Peter Handke schon seit langem langweilig zu finden.