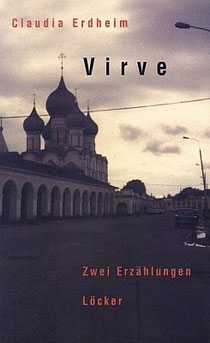Der erste Teil handelt von einer merkwürdigen Frau namens Virve, sie ist estnisch-schwedischer Herkunft, arbeitet als Auslandslektorin in Wien und herrscht inoffiziell über die Besetzung von Universitätsposten in Estland. Porträtiert wird sie vorwiegend über Gespräche und Begegnungen mit der Ich-Figur, die aus ihren Erinnerungsfragmenten ein wenig freundliches Bild montiert: Demnach verhält sich Virve unkollegial, unverschämt und intrigant – Eigenschaften, die sie zwar allseits unbeliebt machen, offensichtlich aber die Karriere fördern. Darin liegt nämlich der Clou dieser Geschichte: Die Schilderung Virves als Unperson endet trocken mit der Nachricht, daß diese zur estnischen Botschafterin in Österreich ernannt werde.
Beide Erzählungen beschreiben am Rande auch die Lebensbedingungen von Schriftstellern. Wird in Virve vor allem die Abhängigkeit von einem hinterfotzigen Literatur-/Wissenschaftsbetrieb angedeutet, so hindert in „Reis, Huhn, Fisch“ chronischer Durchfall die Erzählfigur am Schreiben; schließlich wird ihr Leiden aber zum Anlaß bzw. Stoff für die vorliegende Geschichte. Keiner der aufgesuchten Ärzte, auch nicht die Koryphäen, können helfen, die verschiedensten Untersuchungsmethoden und Therapien werden angewandt: Schulmedizin, Naturheilkunde, Akupunktur, – der Durchfall bleibt und überschattet in zunehmendem Ausmaß den Alltag. Der Speiseplan reduziert sich auf Reis, Huhn und Fisch, die psychische Belastung wächst. Ärzte wie Bekannte reagieren mit der Zeit entnervt; sie spekulieren über psychosomatische Ursachen bzw. fehlendes Bemühen zur Genesung. („Das kenn ich aus der Psychotherapie. Die Patienten, denen man nicht helfen kann, weil’s am Patienten liegt.“)
Auch diese Geschichte endet mit einem ironischen Dreh: Die erlösende Diagnose, die eine Spezialklinik in München schließlich stellt, bestätigt, was die Erzählerin selbst die ganze Zeit über vermutet hatte. Sie leidet an einer nicht ungewöhnlichen Magen-Darm-Krankheit, die durch eine strenge Diät heilbar ist.
Die Texte sind realistisch und auf den ersten Blick selbstentblößend. Erdheim hält sich an die österreichische Umgangssprache, die Schauplätze (und, wenn man sie kennt, vielleicht auch manche der Personen) sind wiedererkennbar. Die autobiografischen Ansätze sind jedoch wie andere Elemente der Erzählung kalkuliert. Man hat es hier mit stilisierten „Selbstporträts“ zu tun, an denen jeweils etwas Konkretes demonstriert wird. Erdheim plaziert ihr fiktives Autorinnen-Ich als Medium der Beobachtung und Erfahrung in unterschiedlichen Versuchsanordnungen, thematischen Ausschnitten, Episoden, in denen das Bewußtsein eines größeren gesellschaftlichen Zusammenhangs dezent mitschwingt. Der informelle und subjektive Gesprächston der Ich-Erzählerin verfängt sich daher nicht in endlosen Assoziations-Verkettungen einer Tagebuchprosa, sondern erzeugt in Verbindung mit genau konstruierten Handlungsmustern lakonische Pointen.