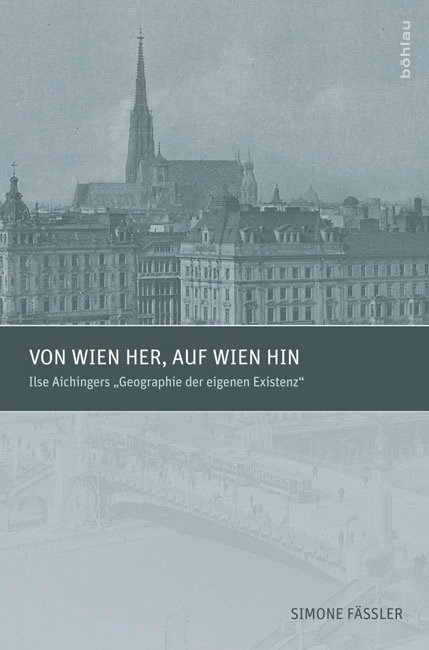Fässler, die 1998 über Ilse Aichingers Ihre Magisterarbeit schrieb, entwickelt in ihrer Untersuchung mit Akribie und Fingerspitzengefühl, wie alle Texte Aichingers „über 60 Jahre hin und durch alle Gattungen hindurch, vom Tagebuch mit Eintragungen aus den Jahren 1943-45 bis zu den Subtexten von 2005 […] vom Raum und der Topographie her gedacht [sind]. Alle bleiben auf ein Grundmuster bezogen, das auch, wo es destruiert wird, präsent bleibt.“ (S. 22f.) Ausgehend von der Analyse der Erzähung „Das Plakat“ als „Raum-, Zeichen- und Lektüremodell“ (S. 33ff.) wird die poetologische Spannung zwischen Situations- und Positionsraum, denen jeweils spezifische Bewusstseinszustände entsprechen, zum Lektüremodell für den Roman „Die größere Hoffnung“ (1948), die szenischen Dialoge in „Zu keiner Stunde“ (1957), die unmittelbarer topographisch verankerte Kurzprosa in „Kleist, Moos, Fasane“ (1987) bis hin zu den späten Feuilletonsammlungen „Film und Verhängnis“ (2001) oder „Unglaubwürdige Reisen“ (2005). Während bei der ersten Sammlung noch ein klarer Gestaltungswille Aichingers für die Buchausgabe nachweisbar ist, wirft die zweite, nur mehr chronologisch gereihte Sammlung – und das ist Fässler als Mitherausgeberin des Bandes durchaus bewusst – schon Fragen in Bezug auf die tatsächliche Autorschaft bzw. das Ausmaß der redaktionellen Eingriffe auf.
Man muss Simone Fässler nicht in allen ihren Thesen folgen, um aus der Lektüre ihres Buches Gewinn für das Verständnis von Ilse Aichingers Poetologie zu ziehen. Die Eigenart, alle Texte vom Raum her zu denken und aufzubauen, in eine Spezifik der Nachkriegszeit einzuordnen, macht zum Beispiel ein wenig misstrauisch. Die Poetisierung der Landkarte – wie sie sich unübertroffen in der Eröffnungsszene von „Die größere Hoffnung“ findet – lag nach 1945 freilich in der Luft. Gerhard Fritschs „Zwischen Kirkenes und Bari“ ist ein zeittypischer Titel, der die Erfahrungen der heimkehrenden NS-Soldaten beschreibt, die Hitlers Eroberungskrieg quer durch die Lande verschlagen hatte – mit der Geschwindigkeit und Todeshäufigkeit von Fliegen, deren eine in Aichingers Eröffnungsszene von Dover nach Callais kriecht. Auch im Hinterland erfuhren Landkarten und Atlanten zwangsläufig eine enorme Aufwertung: Die rasch wechselnden Frontverläufe schwemmten noch nie gehörte Ortsbezeichnungen in Feldpostbriefe wie Tagespresse, und sie konnten über Tod und Leben der Söhne, Väter, Brüder entscheiden. Doch das ist eine fundamental andere Topographie als jene, die das Grundmuster von Aichingers Raummodell konstituiert. Vor dem Hintergrund ihrer Topographie der Verfolgung wiederum ist es verstörend, wenn Fässler in der formalen Analyse von „Die größere Hoffnung“ in der Mitte des Romans eine „potenzielle Öffnung mit der Aussicht einer Deportation nach Polen“ (S. 100) verortet, die zwischen der Schließung der Grenze bei Kriegsausbruch am Beginn und der Befreiung durch die Allierten am Ende des Romans stehe.
Und nicht immer greift die rein assoziative oder metaphorische Lektüre von topographischen Realien. Die Gasometer in Wien Simmering etwa liegen zwar „ein gutes Stück weiter den Kanal hinunter“ (S. 105), an dem auch das Gestapo Hauptquartier am Morzinplatz lag, aber sie lassen sich nicht metaphorisch damit verklammern und auch nicht mit den Gaskammern, sie liegen in einer traditionellen Wohngegend des (Sub)Proletariats, ein Ort potentieller Widerständigkeit mit großer Distanz zum Herrschaftszentrum, zudem in topographischer Nähe zur Wohnung der fiktiven wie der realen Großmutter Aichingers.
Das ändert nichts daran, dass Simone Fässler ein beeindruckender Blick auf Ilse Aichingers Werk gelungen ist, der Variationen und Weiterentwicklungen von Motiven und Dispositiven ihres ersten Romans in späteren Texten nachspürt. Final beendet müsste nach dieser Untersuchung auch die Rede von „Die größere Hoffnung“ als einem Roman aus Kindersperspektive sein: Ellen ist eine Instanz des Romans, die nach eigenen, hochkomplexen Gesetzmäßigkeiten „funktioniert“ und in der Schlussszene – Ellen wird auf der Brücke zerrissen – ihre poetologische Erfüllung findet: „Die Brücke, die diesen Titel [die größere Hoffnung] trägt, ist der Roman. Für das Erzählen bedeutet das Ende des Romans die Erfüllung und Vernichtung.“ (S. 131) Diese Interpretation liegt weit ab von den moralisierenden Fragen, die das Ende Ellens im Befreiungskampf um Wien immer wieder aufgeworfen hat. Ein Eintrag vom 22. März 1943 aus den bislang unpublizierten Tagebüchern Ilse Aichingers, die Fässler im Deutschen Literaturarchiv Marbach eingesehen hat, lautet: „Wenn ein Mensch keine Heimat hat, schwankt alles um ihn, wird kühl und verloren […]. Und immer kommt man zu demselben Schluß: Die Hoffnung ist alles, diese größere Hoffnung, die die Dinge aus dem Schwankenden hinaufreißt in die brennende Existenz des guten Willens. Wenn dann einmal aus dem Feuer dieser Hoffnung der Rahmen einer Heimat geschmiedet wird, ist er reines, leuchtendes Gold.“ (S. 174)