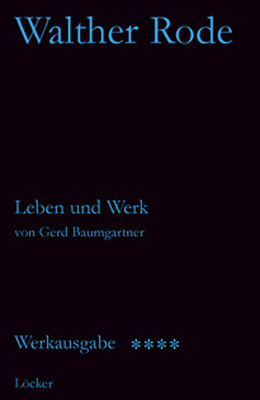Walther Rode hat sich vielleicht gar nicht in erster Linie als Schriftsteller verstanden, zumindest nicht von Anfang an. 1876 in Czernowitz geboren, kam er 1897 nach Wien, schloss das in der Heimatstadt begonnene Jus-Studium ab und etablierte sich als – streitbarer und mit wichtigen Verfahren betrauter – Anwalt. Die Erfahrungen in diesem Beruf machten ihn zum scharfen Kritiker der österreichischen Justiz und des Beamtenapparats – zum Polemiker und Satiriker. Die Grenzen zwischen Plaidoyer und Polemik verschwimmen bei ihm, einige Gerichtsreden hat Rode als Broschüren veröffentlicht, manche ‚Feuilletons‘ argumentieren juristisch. Sein Aufsatz über die österreichische Kriegsgerichtsbarkeit und speziell das Gefängnis auf dem Schlossberg in Laibach (Band 1, 330-333; zuerst 1924 in der Arbeiter-Zeitung), auch sprachlich eindrucksvoll, empfiehlt sich als Gegengift gegen jedwede Verklärung der Habsburgermonarchie. Pointen wie die eingangs zitierte sind bei ihm nie autonom, sondern stehen im Dienst der polemischen Rhetorik; zu würdigen ist er in erster Linie als – literarische Mittel nützender – Justizkritiker.
1928 hat Rode seine Kanzlei geschlossen, Wien (zu dessen coffeehouse wits er gehörte) verlassen und von der Schweiz aus (wo er 1934 plötzlich gestorben ist) nur noch als Publizist gearbeitet, für angesehene Zeitschriften und Zeitungen in Österreich, dem Deutschen Reich, der Tschechoslowakei und zuletzt in den Exilländern.
In den traditionellen Gattungen hat sich der Autor kaum versucht; von bemerkenswerter Qualität sind seine zahlreichen Feuilletons und kleinen satirischen Texte, die sich zunehmend von juristischen Themen entfernen. „Sinologen untereinander“ (1930; Band 3, 289-292) beschäftigt sich sozusagen mit der Theorie der Polemik; „Los von Taxenbach“ (1922; 303-306) ist eine aktuell gebliebene witzige Analyse innerösterreichischer Spannungen; „Lurchokratie“ (1932; 325-329) charakterisiert den ‚Ständestaat‘ schon vor dessen Etablierung. Usw.
Am Ende von Rodes Wirken steht sein Pamphlet gegen Hitler, Deutschland ist Caliban, Zürich 1934 (Band 3, 127-253), mit scharfen Einsichten in die geistigen Voraussetzungen wie in die Pläne der neuen Machthaber in Berlin (180: „Das Dritte Reich ist das Zusammentreffen des großen Fälschers Houston Stewart Chamberlain mit dem Tapezierergehilfen Adolf Hitler.“). Interessant ist daran vieles; so die leidenschaftliche Betonung der Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich – bei einem Autor, der das alte Österreich heftig kritisiert hatte und dem die Österreich-Idee des Ständestaats gewiss fremd gewesen ist (z. B. 175: „Der österreichische Mensch ist keine Erfindung der habsburgischen Hausgeographen. Er begreift sich als Mensch und nicht als Deutscher.“; vgl. auch eine in der Bibliografie verzeichnete Stellungnahme zum Anschluss von 1925). Dass manche Passagen bloße Deutschland-Beschimpfungen sind – nicht einmal immer witzige – , soll nicht verschwiegen werden. Selbst in diesem politischen Pamphlet denkt Rode übrigens erstaunlich oft als Jurist.
Auf die spezifisch justizkritischen Schriften, von denen manche eine Typologie der immer gleichen Vorgänge vor Gericht entwerfen, andere scharfe Portraits von Richtern und Anwälten sind, einige grundsätzliche Rechtsfragen erörtern (zum Teil aus anwaltlicher Perspektive und mit geringerem, aber nicht geringem literarischen Aufwand), gehe ich im Detail nicht ein. Ob alle behandelten Rechtsfälle bis heute typisch sind, möchte ich bezweifeln; die Affäre Hauser-Devrient (Band 2, 57-143) etwa scheint mir ein interessanter Stoff für einen Krimi – aber Rodes abgeschmetterte Eingaben, unter dem genialen Titel „Wenn sie nicht wollen“ zusammengefasst, wirken auf den Nicht-Juristen eher weitschweifig und wenig überzeugend. Das gilt in abgeschwächter Form auch für andere Schriften, die mehr Schriftsätze des engagierten Anwalts Rode als Schriften des gleichnamigen Autors sind, selbst wenn sie polemisch von Rechtsfragen als Fragen des Missbrauchs des Rechts handeln. Es wird kein Zufall sein, dass ein Anwalt den Autor Rode wieder entdeckt, diese Ausgabe initiiert und sie betreut hat. Insgesamt zeichnen die hier versammelten Beiträge ein düsteres Bild von der österreichischen Justiz im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, und nicht nur von der österreichischen Justiz, sondern von Österreich …
Editorisch ist Baumgartner den einfachsten Weg gegangen: Er hat Rodes Bücher nachgedruckt. In der – wohl sehr vollständigen, jedenfalls sehr sorgfältigen – Bibliografie im 4. Band, zu der die Finde-Meister Gregor Ackermann und Eckart Früh beigetragen haben, findet man (ohne Verweise auf die Nachdrucke in den Büchern) die Zitate der Erstdrucke – nach einigem Suchen. Die „Vorbemerkung des Herausgebers“ im 1. Band teilt zwar mit, Rode habe Artikel für die Buchausgaben überarbeitet, gibt aber kaum konkrete Informationen zu diesen Überarbeitungen. Das ist insofern zu rechtfertigen, als es jetzt einmal darum geht, den Autor in Erinnerung zu rufen; das ist insofern bedauerlich, als Überarbeiten wie Unverändert-Lassen für Rodes eigene Einschätzung seines Werks aussagekräftig wären; einige Beispiele hätten ja genügt. Man möge mich nicht missverstehen: Keineswegs ist eine kritische Rode-Ausgabe zu fordern (auch nicht für die Zukunft), nur etwas genauere Informationen zu Erstdrucken und Veränderungen möchte ich einfordern. Manchmal wäre eine ausführlichere Kommentierung angebracht, wenigstens für Nicht-Juristen. (Allerdings erhellt Baumgartners Biografie im 4. Band viele Details; es ist ratsam, sie vor der Lektüre der Texte zu überfliegen.) Dass die Untertitel von Deutschland ist Caliban – nämlich „Deutsche Revolution“ und „Streitschrift und Pamphlet“ – nicht der Ausgabe, sondern nur einer Abbildung in der Biografie (Band 4, 287) entnommen werden können, dürfte ebenso wenig passieren wie die unbegründete Änderung des Titels von Justiz, Justizleute und anderes in ein einfaches „Justiz. Fragmente“ (Band 2).
Über die Kriterien, nach denen der Herausgeber aus der Fülle von Rodes Feuilletons ausgewählt hat, wüsste man ebenfalls gerne mehr. Ein für den Autor wie für die Zeitgeschichte so fundamentaler Text wie seine Auseinandersetzung mit seiner ihm lange wenig wichtigen jüdischen Herkunft (aus der Ostjüdischen Zeitung von 1934) ist nur in der Biografie, S. 295-298, verborgen zu finden (immerhin das!); er müsste selbstverständlich unter den Feuilletons stehen. Nicht wenige in der Bibliografie verzeichnete, hier nicht wieder gedruckte Artikel Rodes möchte ich jedenfalls einmal lesen …
Baumgartners sehr sachliche Biografie, die unter dem Titel „Leben und Werk“ den 4. Band füllt, enthält sich jeder literarischen Wertung. Da über den Menschen Rode nur wenig eruiert werden kann – es gibt keinen Nachlass und auch sonst wenig Spuren – , ist sie über weite Strecken eine (gut recherchierte, auch auf anderen Quellen als Rodes Schriften beruhende) Darstellung der Prozesse, in denen der Anwalt Rode tätig gewesen ist. Zu dessen literarischer Würdigung findet sich einiges in der vorzüglichen Einleitung Klaus Werners zum 1. Band (gegen die man allenfalls einwenden kann, dass sie den Wiener Aspekt von Rodes Leben unter-, die Bedeutung seiner Czernowitzer Herkunft überschätzt.)
Abschließend: Die Wiederentdeckung Rodes lohnt sich, wegen der Qualität seiner Texte, wegen der vielen (unschönen) Einblicke in das Österreich der ausgehenden Monarchie und der Ersten Republik, wegen seines Witzes. Literatur-Interessierte schulden dem ‚Außenseiter‘ Baumgartner für die Möglichkeit dieser Wiederentdeckung Dank.