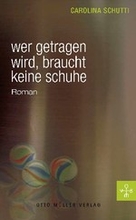wer getragen wird, brauch keine schuhe könnte auch an Ausschwitz-Literatur erinnern oder den Beginn einer Bergromanze markieren; letzteres ist von Carolina Schuttis plot gar nicht so weit weg.
Anna ist gerade einmal achtzehn und geht von einem Tag auf den anderen aus ihrem Elternhaus fort, wo Schreckliches passiert sein muss. Das Elternhaus steht naturgemäß irgendwo in der Provinz, am Land, und die Familie ist – naturgemäß, möchte man sagen – in ein Schweigen gefallen ob des Schrecklichen, das ihr widerfahren ist. Es geht um das Geschwisterchen von Anna, das vermutlich tot ist. Da kann man schon einmal flüchten, vor allem, da sich Anna am Tod ihres Bruders schuldig fühlt. Pflichtbewusst betäubt sie sich in der Beziehungslosigkeit der Großstadt, nimmt eine Stelle als Kellnerin an und wohnt karg und einsam in einer kleinen Wohnung. Sie hat ständig kalt und Angst und trägt eine Reihe von Marotten mit sich herum. Sie ist ein wenig eigenwillig, ein wenig depressiv, vor allem aber todtraurig; so todtraurig, dass man bei der Lektüre weinen möchte. Man empfindet Mitleid und möchte die arme, arme Anna beschützen, ein klein wenig trösten.
Das übernimmt schließlich Harald, den sie im Gasthaus ein paar Mal bedient und der sich vom Fleck weg in Anna verliebt. Vielleicht ist es auch nur simples Begehren, denn Harald ist ein Womanizer, der seine Romanzen auf zahllosen Fotos archiviert und im Schuhkarton ablegt, bevor er zur nächsten Eroberung schreitet. Doch Harald bemüht sich ehrlich, drängt die schüchterne Anna nicht, bedrängt sie nicht, sondern hilft ihr behutsam, sich zu öffnen wie eine späte Bergblume, die sich erst im Spätsommer zaghaft und scheu – es leckt noch Schnee ins Tal – öffnet, während ihre Kolleginnen in der Ebene bereits verblüht sind. Annas Knospe öffnet sich vorsichtig und sie empfängt scheu wie die Jungfrau das Liebeswerben, dann die Liebe. Für einen Moment ist so etwas wie Erlösung, wie Hoffnung möglich.
Der Berg ruft dann tatsächlich, denn Harald nimmt Anna mit auf eine Wanderung, die beide an die Grenzen der Belastbarkeit bringt. Erschöpft retten sie sich in eine aufgelassene Hütte samt Kapelle eines ehemaligen Bergwerks. In einem kathartischen Akt voll Schaudern und Zittern verbringen die beiden eine Nacht in der Kapelle und die Heiligenfiguren richten über Schuld und Nichtschuld, zwei verirrte Seelen und der lastende Druck des Geschwisterchen-Tods. Anna hat sich endgültig geöffnet, beichtet, während Harald, anstatt dieses Geschenk annehmen zu können, bereits seinen Absprung zur nächsten Geliebten vorbereitet. Er ist der untreue Wilderer, der sich nur als Jäger ausgibt, am Ende ist also auch auf ihn nicht Verlass.
Das Ende ist zwangsläufig ein trauriges, ein offenes Fenster, Engel, die sprechen und ein Aufwachen im Krankenhausbett. Anna kann sich nicht von ihren Dämonen, den Teufeln, befreien und Harald stiehlt sich aus der Verantwortung. Die Trauer ist ein Stachel, den keine Maus aus der blutenden Löwentatze ziehen kann, es gibt keine Vergebung.
Schutti baut ihren Roman als eine Art Triptychon, jeder kommt einmal zu Wort, drei Teile mit Motti, die die Schuhmetaphorik des Titels nach und nach ins Sakrale rücken. Sie beschreibt sehr genau, in klaren, kurzen Sätzen. Genaue Beobachtungen und endlose Reflexionen drehen sich am Ende immer im Kreis und enden bei der Schuld am Tod des Geschwisterchens, der wohl gottgegeben sein muss, sonst könnte man nicht so gut trauern, so wahrhaft traurig sein. Was dieser Versuch einer Liebe, die sich doch nur als unmöglicher Versuch von Trauerarbeit entpuppt, wirklich sagen will, das bleibt im Dunklen. Vielleicht wissen es die Engel, die sonst ja alles wissen, oder in den Worten der Autorin: „Was uns retten kann, ist die Liebe, hat Harald einmal gesagt. Den Zusammenhang weiß ich nicht mehr.“ (S. 117)