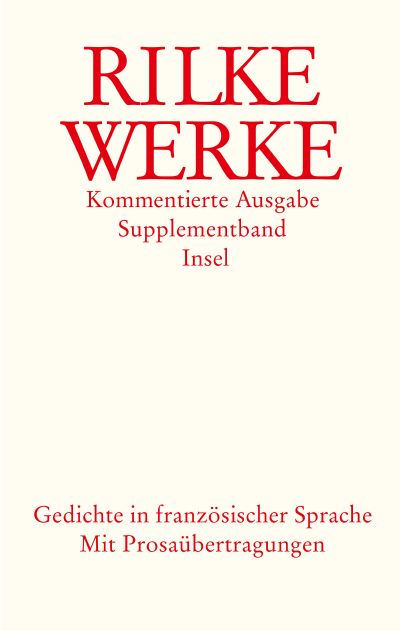Rilke war, was mehrsprachige Publikationen anging, eine der interessantesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Wir kennen ja nicht nur die in diesem Band versammelten französischen Dichtungen, sondern auch zahlreiche Texte und Übersetzungen in russischer oder italienischer Sprache. Damit gehört Rilke zu den polyglotten Doppel- und Mehrfachbegabungen wie Joseph Conrad, Oscar Wilde, Tristan Tzara, Ionescu, Cioran, Goll oder Nabokov, die es verstanden, Kulturen und Sprachen zu vermitteln.
Bei der Präsentation der Gedichte haben sich die Herausgeber Manfred Engel und Dorothea Lauterbach entschlossen, den Zugang durch Prosaübertragungen zu erleichtern, welche Rätus Luck besorgte. Der Verzicht auf eine ‚kongeniale‘ lyrische Übersetzung oder auf Glättung der Verstöße gegen grammatische oder semantische Regeln ist eine kluge, eine zurückhaltende Entscheidung, die überzeugt. Man habe – so steht es in dem ausführlichen Kommentar zu lesen, der mit 386 Seiten über die Hälfte des Buches ausmacht – keineswegs „poetische Äquivalente“ finden wollen, sondern eine eher „verfremdende“ Übersetzung angestrebt, die versucht, syntaktische Zusammenhänge, Interpunktion, die Grundbedeutung eines Wortes zu überliefern, jedoch semantische Befremdlichkeiten beläßt, auch wenn sie zunächst als falsch empfunden werden.
Solche Zurückhaltung und Offenheit gegenüber den Schwachstellen nimmt kritischen Einwänden den Wind aus den Segeln. Sicher ist richtig, daß Übersetzen immer auch heißt zu vereindeutigen, was Poesie in ihrem ästhetischen ‚Überschuß‘ und ihrer Ambiguität erst ausmacht. Aber das Versprechen, solche Mehr- und Neben-Deutigkeiten dann im Kommentar klären zu wollen, hat seine Grenzen.
Wenn gleich zu Beginn des Bandes im Gedicht „Ce soir mon coeur fait chanter/ des anges qui se souviennent…“ (aus den „Vergers“) das Motiv der Engel kommentiert oder im Gedicht „L’indifférent“ ’sourire‘ als „Lächeln als Zeichen der zustimmenden Annahme des Lebens“ paraphrasiert wird, dann spürt man das Dilemma zwischen angekündigter interpretatorischer Hilfe und Askese.
Man hat – anders als bei den Gedichten – sich entschlossen, die im Anhang publizierten französischen Briefe und Selbstauskünfte Rilkes nicht zu übersetzen; mit der Begründung, daß es dann einen Rilke-eigenen Kommentar zu seiner Dichtung gäbe, der wiederum hätte kommentiert werden müssen. Doch Platzmangel scheint nicht im großen, etwa wo man sich ausführlich zu Deutungsaspekten äußert, sondern im kleinen regiert zu haben. Großzügigkeit in jenem Teil des Kommentars, der Rilkes autopoetische Äußerungen – etwa gegenüber Briefpartnern – dokumentiert, hätte dem Auge gut getan, wo man statt dessen an einer einzigen Leerzeile zwischen den Empfängern spart; Leerzeilen, die später (so bei den Reaktionen der Zeitgenossen) durchaus zu finden sind.
Sicher ist eine Edition, die wie jede zwischen (leichter) Lesbarkeit und philologischer Akkuratesse entscheiden muß, im Falle eines fremdsprachigen Werks besonders schwierig. Und was die Herausgeber einmal den „Mut zur Spekulation“ nennen, könnte mitunter auch der Mut der Verzweiflung sein. Man muß das gelassen nehmen, gehören solche Unzulänglichkeiten doch zum Editionsgeschäft; wie jene, daß zunächst die Entscheidung, die Gedichte chronologisch zu präsentieren, ausführlich diskutiert wird und sich ebenso rasch die Unmöglichkeit zeigt, Chronologie überhaupt zweifelsfrei festmachen zu können (was sich in vagen Angaben wie „14./23. 8. 1924“, „Frühjahr 1925“, „Um den 1.9.1924“ oder den Zusatz „vermutlich“ niederschlägt).
Am Ende entläßt diese Ausgabe den Leser – fast notwendigerweise – mit zwiespältigen Gefühlen. Dennoch ist es jene schöne Möglichkeit, gerade diese ‚Nebensächlichkeiten‘ Rilkes als Impulse zu eigenen Spracherkundungen in fremdes Terrain spielerisch zu entdecken, was Preis und Aufwand eines solchen Unternehmens rechtfertigt.