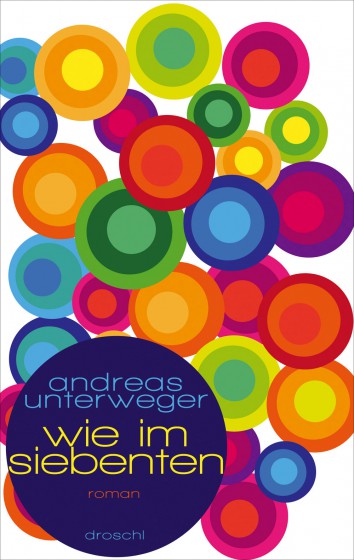Das Leben kann so einfach sein: schreiben, schlafen, mit Judith schlafen, Gitarre spielen, Nutellabrote essen. Schreiben gegen das intellektuelle Verhungern, schreiben, um zu leben: „Ich schrieb im Park, im Café Nil, im Bett. Ich schrieb in einen Laptop, schrieb im Internetcafé, ich schrieb mit schwarzen Finelinern in Schreibblöcke: Sie waren alle 160 Seiten dick.“ Schreiben, um zu leben, leben, um zu schreiben. Das Schreiben nicht nur als Lebensentwurf, nein, als pure Existenzfrage. Schreiben aus einem Lebenshunger, der unbändig ist.
Noch ein Buch über einen Schriftsteller, der über das Schreiben schreibt? Noch ein Buch über die Frage, ob das Schreiben und das Leben zusammengehen? Ja, noch eins, ein erfrischend freches. Unterweger spielt und jongliert in jugendlicher Unbekümmertheit mit den Erzählebenen, die Frage, ob postmodernes Schreiben noch zeitgemäß ist, kratzt ihn nicht – recht so! Er integriert Fotos in seinen Roman, er zitiert, er zitiert Autoren, die es nicht gibt, er schweift ab, betreibt Dylanologie, spielt mit der Herausgeberschaft des Textes, fügt Anmerkungen und Textfragmente an. Man stelle sich einen jungen, gut aufgelegten Thomas Bernhard vor (auch wenn das widersprüchlich sein sollte): So lesen sich die Sätze des Romans. Da wird wiederholt, wird insistiert, da steckt viel Humor drinnen. Sprachlich hat der Text Hand und Fuß, keine Frage.
Es kommt, wie es kommen muss, jugendlicher Idealismus und Zauber des Anfangs hin und her, unser junger Held und seine Liebste werden von der Wirklichkeit eingeholt, wie jeder von der Wirklichkeit eingeholt wird. Sie, die einen dreijährigen Sohn hat und nur während der Woche bei ihm im Siebenten wohnt, weil sie in der Stadt arbeitet, ist abends oft müde. Was sich anfangs genügte, genügt plötzlich nicht mehr. Beider Liebe nutzt sich im sogenannten Alltag ab. Kein Happy-End.
Unterweger hat sehr viel riskiert, das macht sein Debüt sympathisch.
Ein Lichtblick im herbstlichen Neuerscheinungsreigen!