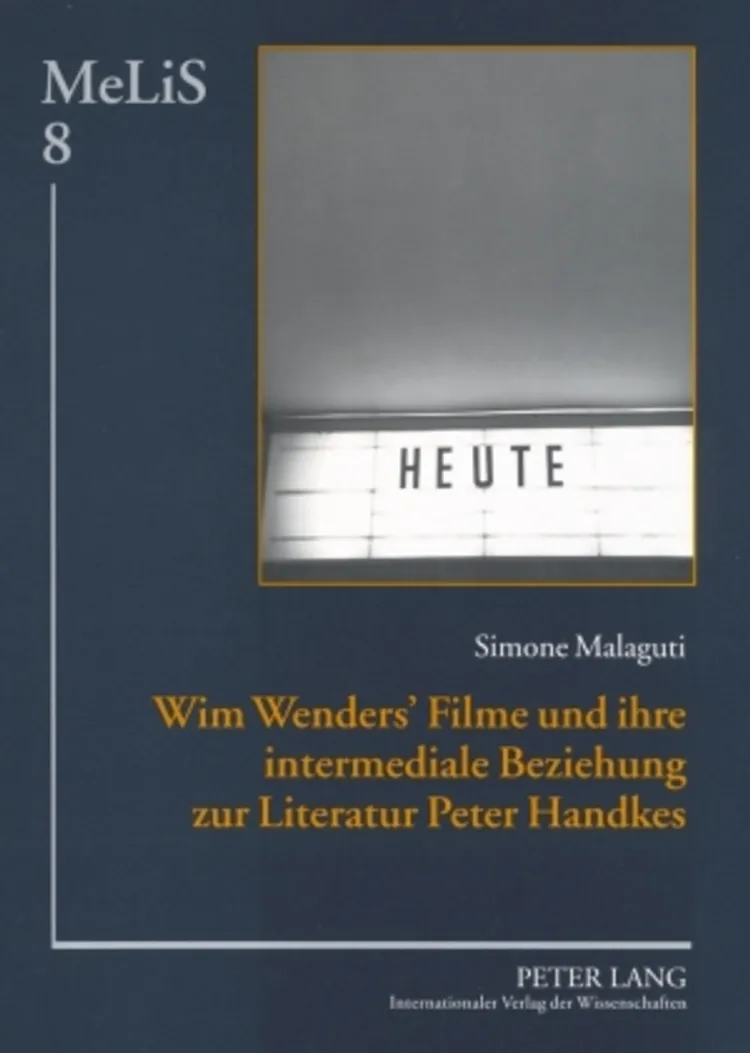Ausgangspunkt ist eine theoretische Einführung (Kapitel 2) in „Film, Literatur und Intermedialität“, die im Wesentlichen auf einer semiotischen Zeichentheorie aufbaut, die Malaguti mit ähnlicher Differenziertheit und Klarheit wie Eco oder der ‚frühe‘ Barthes auszubuchstabieren imstande ist. Eine wichtige These, auf die die Untersuchung der spezifischen Verbindung zwischen Wenders und Handke aufbauen kann, ist die Entwicklung des Spielfilms aus der Literatur. Diese These bedarf einer genauen Analyse des Zusammenhangs des Intertextualitätsbegriffes mit dem der Intermedialität, die Malaguti durch einen ausführlichen Rückgriff auf die Intertextualitätstheorien von Kristeva, Bachtin und Genette (in dem sie zeigt, dass sie das methodische Handwerk der Intermedialitätsforschung beherrscht) leistet. Auch wenn an einigen Stellen der erwähnte Zusammenhang etwas unklar bleibt, so vermag die Autorin doch ein System von Begriffen vorzustellen, mit dem die vielfältigen Bezüge zwischen literarischem Prätext (Handke) und filmischem Intertext (Wenders) ausreichend differenziert analysiert werden können.
Trotz der Konzentration auf eine semiotische Zeichentheorie verabsäumt es die Autorin nicht zu betonen, dass ohne Rezeption keine Interpretation stattfinden kann, dass also ein konkretes Publikum die „Marker“ im Intertext aktualisieren muss. Auch wenn das nicht weiter vertieft wird, ragt hier die Arbeit über viele mit vergleichbarer Thematik und ähnlichem theoretischem Ansatz hinaus. Zudem, auch dies eine beachtliche und wichtige Erweiterung gängiger Interpretationsmodelle, vergisst Malaguti nicht, dass die die Rezeption steuernden „Marker“ nicht nur im Intertext zu finden sind, sondern auch im „Kommunikationssystem der Werke“ (S. 43), also etwa in Pressemitteilungen oder in Interviews mit AutorInnen und RegisseurInnen. Solchermaßen gewappnet kann die Autorin auch erklären, warum nicht nur der Prätext den Intertext beeinflusst, sondern auch umgekehrt: Eine ‚Verfilmung‘ eines Handke-Textes beeinflusst über den Kontext des Literatursystems ja auch die Bedeutungen des Textes selbst. Naheliegenderweise hätte man an dieser Stelle auch mit systemtheoretischen Zugängen oder auch jenen der Empirischen Literaturwissenschaft argumentieren können, aber dies der Autorin zum Vorwurf zu machen wäre ähnlich absurd wie der Vorwurf der älteren Dame (aus dem bekannten Witz), die anlässlich des weihnachtlichen Festessens ihren Schwiegersohn, dem sie zuvor zwei Krawatten geschenkt hat, von denen er eine trägt, ganz enttäuscht die Frage stellt, ob ihm die andere nicht gefallen habe. Das Kapitel 2 bietet – selbst wenn einige zusätzliche Beispiele zur Erläuterung an der einen oder anderen Stelle hilfreich gewesen wären – im Übrigen auch dann eine gute Einführung in die Diskussion des Intermedialitätsbegriffes im Zusammenhang mit dem Thema Literaturverfilmungen, wenn man sich nicht für Peter Handke und Wim Wenders interessiert.
Kapitel 3 besteht – bereits im Hinblick auf die beiden im Zentrum stehenden Künstler – aus allgemeineren filmtheoretischen Überlegungen. Malaguti zeigt auch in diesem Kapitel, dass sie fähig ist, die Untersuchung von (Kunst-)Werken in einen größeren Kontext einzubetten, beschreibt sie doch in einem historisch-theoretischen Abschnitt, wie sich der Film in einer Zeit des Kolonialismus und Imperialismus entwickelte. So nimmt die Autorin, und auch dies ragt über den Durchschnitt vergleichbarer Untersuchungen heraus, künstlerische Werke innerhalb allgemeinerer gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge wahr. Kapitel 3 vermag auch gut zu erklären, warum ausgerechnet Wenders und Handke (der, wie auch die Autorin erwähnt, im Übrigen als Filmkritiker tätig war) zueinander fanden: Beide eint das Interesse an intermedialen Bezüge, und beide eint nicht nur die Überzeugung (die sie mit vielen anderen KünstlerInnen der 1960er-Jahre teilen), dass die Kunst in irgendeiner Form die Geschichte des Nationalsozialismus, der die deutsche und österreichische Gesellschaft zutiefst korrumpiert hat, zu reflektieren habe, sondern auch die Überzeugung, dass dies nur auf einem avantgardistischen Wege der Arbeit an der Form zu bewerkstelligen wäre. Ist doch nach 1945 auch die Sprache selbst korrumpiert. Und mit dieser Überzeugung hat sich Handke bekanntlich – und Malaguti erinnert auch daran – 1966 in Princeton und in vielen Texten in der Folge gegen die Gruppe 47 gestellt.
Eine zentrale Rolle in den Ausführungen Malagutis spielen der einflussreiche Filmkritiker André Bazin sowie die französische „Nouvelle Vague“. Auch wenn letztlich die Analyse der intermedialen Zusammenhänge zwischen Wenders und Handke auch ohne diese Überlegungen Gültigkeit für sich beanspruchen können, bieten die entsprechenden Passagen doch erhellende Gedankengänge. Die Bemerkungen der Autorin zur Entwicklung von Kunst und Kultur in den 50ern und 60ern ganz allgemein bleiben etwas an der Oberfläche, was im Zusammenhang mit dem eigentlichen Thema der Untersuchung jedoch nicht weiter stört. Dankbar ist man über diese Kontextualisierungen der beiden Künstler (etwa Handkes Verortung im Grazer „Forum Stadtpark“ oder in der „Wiener Gruppe“) aber doch, denn deren frühen Werke werden so besser verständlich.
Den eigentlichen Hauptteil des Buches bildet das Kapitel 4, das die „Werkanalysen“, das heißt die Zusammenhänge (Einzel- und Systemreferenzen) zwischen den Filmen und den Texten vorstellt. Jeweils von den Filmen ausgehend werden folgende Werk bzw. Werkkomplexe untersucht:
(1) „Die Angst der Tormanns beim Elfmeter“ als Nachahmung des gleichnamigen Textes, der den primären Prätext bildet, während „Das Zittern des Fälschers“ von Patricia Highsmith einen sekundären Prätext darstellt.
(2) „Alice in den Städten“ als Evokation von „Der kurze Brief zum langen Abschied“ als primärem Prätext und anderer, teilweise von Handke, teilweise von anderen stammenden sekundären und tertiären Prätexten.
(3) „Falsche Bewegung“ als interpretierende Transformation des gleichnamigen Textes, wobei Handkes Text neben Eichendorffs „Taugenichts“ und Flauberts „Lehrjahre des Gefühls“ einen sekundären Prätext darstellt, Goethes „Wilhelm Meister“ den primären.
(4) „Paris, Texas“ als Transfiguration von insgesamt acht Prätexten, darunter sechs von Handke, von denen „Langsame Heimkehr“ der wichtigste ist und von Wenders aus Gründen fehlender Finanzierung nicht verfilmt werden konnte.
(5) „Der Himmel über Berlin“ als Zusammenarbeit von Wenders und Handke. Malaguti macht deutlich, dass die intermedialen Bezüge in diesem Falle nur dann analysierbar sind, wenn man „die Erweiterung der vorgeschlagenen Systematik in Form von Nuancierungen und Relativierungen, Unterformen oder Überschreitungen der Nachahmung, der Evokationen, interpretierenden Transformationen und Transfigurationen und durch das Zusammenspielen dieser vier Konzepte“ ins Auge fasst (S. 172).
Die Werkanalysen können als durchwegs gelungen angesehen werden, nur die fünf kurzen Resümees fallen etwas zu mager aus. Die Schlussbetrachtung hingegen bietet eine treffende und klärende Zusammenfassung. Trotz einiger Redundanzen, vereinzelter trivialer Feststellungen und durch unpräzise Begriffsverwendungen hervorgerufene Unklarheiten vermag das Buch zu überzeugen, und daher verzeiht man der Autorin auch einige Gemeinplätze: Dass wir in der „Tradition einer auf Schrift zentrierten Kultur“ leben würden ist richtig, aber dass diese „inzwischen durch die Umbrüche des letzten Jahrhunderts und die neuen Medientechnologien heute allerdings als überholt gelten muss“ (S. 30), ist ein allzu oft nachgebeteter Irrtum, der nicht durch Wiederholung wahr wird: Natürlich leben wir in einer Medienwelt, aber Texte spielen darin keineswegs eine marginale Rolle. Zu überzeugen vermag das Buch vor allem auch dann, wenn man bedenkt, dass es sich – wie bereits betont – um die Dissertation Simone Malagutis handelt. Wenn man die finanziellen Möglichkeiten bei der Publikation von Dissertationen berücksichtigt, dann verzeiht man der Autorin die Tatsache, eine ausführliche und insgesamt exzellente Dissertation, die bei einem leserfreundlicheren Druckbild gut und gerne 300 Seiten aufweisen müsste, auf 206 Seiten untergebracht zu haben. Wenn jemand vor Drucklegung noch die vielen, wie es scheint manuell gesetzten, Bindestriche entfernt hätte, dann wäre die Freude über einen nahezu fehlerfreien Text ungetrübt. (Und wenn der Rezensent schon beim Erbsenzählen ist: Der Berry, der in „Alice in den Städten“ neben anderen für die Musik verantwortlich zeichnet, heißt natürlich Chuck, nicht Checky.)