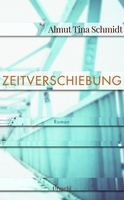Die verschiedenen „Etwasse“ in ihrem Bauch und ihrem Kopf machen der Protagonistin schwer zu schaffen, doch die Überwindung der Zeit ermöglicht ihr, eine neue Lebensqualität zu finden. Zeitdilation ist ein Phänomen, das auftritt, wenn man zwei Uhren gleichzeitig betrachtet und die zweite unweigerlich langsamer zu ticken scheint. Die Ausdehnung der Zeit – und deren Verschwendung – hat sich auch die Autorin des vorliegenden Romans Zeitverschiebung zum Thema gewählt.
Sie meditiert – in leicht hektischem Tonfall – über allerlei zeitpolitische Ereignisse und nebenbei über ihre bevorstehende Schwangerschaft und Geburt sowie ihre unzähligen FreundInnen und deren Talent zur Zeitverschwendung. Die Autorin schreibt gerne viele Dinge in Klammern und nimmt darin Ereignisse vorweg, die erst später im Roman passieren werden. Klammern wurden bisher dazu verwendet, ergänzende Erklärungen hinzufügen, Einschübe zu machen, Denkpausen anzuregen. Ein kluger Schachzug also, wenn die Autorin in ihrem Roman über Zeitverschiebung gleich mehrere Zeitebenen nebeneinanderstellt, die Klammern einer neuen Verwendung zuführt und so der Zeitverschwendung vorzubeugen versucht, in dem sie vorher schon andeutet, was passieren wird.
Die Protagonistin des vorliegenden Romans schreibt an ihrer Diplomarbeit über den amerikanischen Beatautor Jack Kerouac, als sie auf der Hochzeit einer Freundin deren Ex-Freund Jan kennenlernt, der selbst gerade nach Amerika aufbricht. Aus einem flüchtigen Gespräch wird eine Brieffreundschaft und schließlich sogar mehr, denn trotz der Zeitverschiebung zwischen den USA und Europa leben die beiden sozusagen auf derselben Welle und – wie der Leser aus den Klammen erfährt – auch bald mit einem „Happy End“. Aber auch in den Beziehungen zu ihren FreunInnen geht es immer wieder um Zeit. Da gibt es den Freund von Meret, der starb, weil er eine Abkürzung nahm, um pünktlich zu kommen oder die Tante, die rechtzeitig an der Bushaltestelle stand und von einer Splitterbombe im Mülleimer zerfetzt wurde. Die Protagonistin selbst kommt deswegen immer zu spät, denn wozu der Stress, wenn einen ohnehin nur das eigene Schicksal am Ende der Straße erwartet? (Unpünktlichkeit als Zeitdilation.)
Jack Kerouac hatte seinen Kultroman On the road in nur drei Wochen geschrieben und für die Reise selbst, die er darin unternimmt, ein ganzes Leben gebraucht. Als Verpflegung soll er übrigens Apfeltorte und Eiscreme empfohlen haben, die sich die Ich-Erzählerin gerne auch während der durchwachten Schreibnächte an ihrer Diplomarbeit gönnt. „Andererseits: was ist schon Effizienz – letztlich doch nur was für Leute, die wirklich Zeit haben.“, schreibt sie an einer Stelle. Ihre Freunde hingegen verschwenden ihre Zeit mit „Prokrastination als Lifestyletrend“. Oder mit Kulturmanagement. Oder mit Distanzierungsspots auf einem privaten Videochannel. So wie Tobias. Oder Vincent, der in seiner Freizeit Lebensversicherungen und Bausparverträge abschließt. Oder Daniela mit ihrem Deutschlektorat in Kyoto. Oder Melanie, die sehr viel Zeit mit Fastenkuren und Paartherapie verschwendet. „Ich verschwendete mehr und mehr Zeit damit zu fürchten, meine Zeit ernsthaft zu verschwenden.“ Oder wie sie mit Shakespeare ihren in Amerika weilenden Kindsvater wissen lässt: „I wasted time and now doth time wastes me“.
Eyjafjallajöküll, 9/11, das Attentat in Paris, das überflutete New Orleans, der arabische Frühling, Touristenentführungen in Ägypten oder das Jubiläum der Tschernobyl-Katastrophe, das just in dem Jahr begangen wurde, in dem die noch viel größere Katastrophe von Fukushima geschah, unterbrechen die Überlegungen der Protagonistin, wie sie ihrem Diplomarbeitsthema und ihren „vielen Ichs und Etwassen“ Herr werden könnte. „Ich vermisste die sonst so verlässliche Angst, irgendetwas zu verpassen. Ich vermisste meine alte selbstbestimmte Unpünktlichkeit.“, konstatiert sie ihre eigene Veränderung. Auf einer Party bei Freunden wird ihr schließlich bewusst, dass sie es jetzt ja eigentlich viel besser hätte: „Die andere durfte trinken, ich hatte meine Hormone.“ Die größte Party findet schließlich auf dem Bett ihres Gynäkologen statt; die Geburt ihres Kindes. So eine Geburt sei ja wie untrainiert einen Viertausender zu besteigen, sagt eine Freundin. Und auch wenn darauf keine Euphorie folge, so doch zumindest ein ganz großes anderes Gefühl: Erleichterung. „Ich habe stumm vor mich hingeredet, immer auf der Suche nach einer Erzählspur aus der es mich nicht herausschleudert.“ Das Kind bejaht und nimmt sich alle Zeit der Welt. Ein atemloses Plädoyer für die Entschleunigung des Alltags.