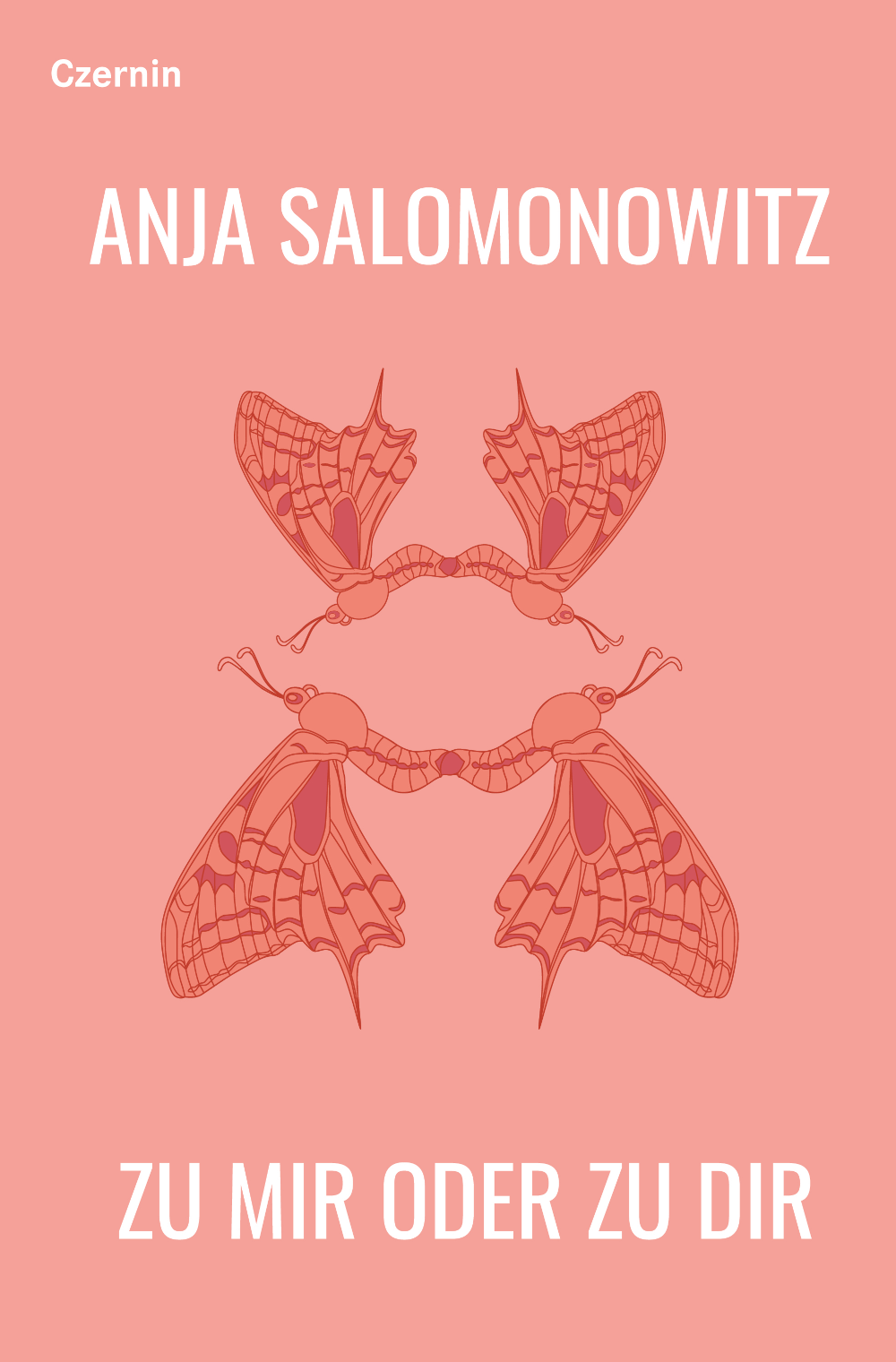Auf einer dokumentarischen Ebene lässt die Autorin junge Tinder-User:innen von ihren Dating- Erfahrungen berichten, auf einer fiktiven Ebene legt sie diese Erzählungen den Bewohner:innen eines Altenheims in den Mund und erzeugt so einen Effekt der Verfremdung, der für erstaunliche, berührende und poetische Momente sorgt. Wie in einem Traum folgen wir der Kamera durch lange Gänge und Räume, sehen alte Menschen beim Essen, Schlafen oder Baden, im Rollstuhl oder im Sterbebett, während sie in der Sprache der jungen, digitalisierten Generation über Tinder-Dates, schnellen Sex, Liebe und Weltschmerz sinnieren. Beide Ebenen verweben sich nahtlos zu einer vielstimmigen Erzählung, die nicht nur die Oberflächlichkeit, sondern auch die tiefen Sehnsüchte und Ängste der Menschen beleuchtet.
Die ersten Kameraeinstellungen gelten dem Ort des Geschehens, wir schweben hinein in eine helle Empfangshalle, in geflieste Gänge, leicht zu putzen, irgendwoher tönt eine Oper, es gibt große, alte Fenster, Böden aus Linoleum, weiße Flügeltüren wie in einem Spital der Jahrhundertwende, man denkt an Thomas Manns Zauberberg, bis Johann, der Pfleger auftritt, lange Haare, „schwer tätowiert“, „schwer sympathisch“, „eine Kapuze über der Jacke“ (S. 9). Wir folgen ihm in die Umkleidekabinen, sehen weiße Kleidung, Clogs von Ikea und Crocks aus Plastik. Gegenüber, im Nebenraum, die Frauen: Janina, die Putzfrau, Johanna, die Altenpflegerin, missmutig, Janette, ihre junge Kollegin, freundlich. Ein ganz normaler Tag beginnt. Doch dann sagt Johann, während er sich vor dem Spiegel die langen Haare richtet, zu seinem Kollegen Josef und dem Koch folgendes:
„Ich war mit meinem Alphabet, wie man jemanden findet, einfach am Ende. Also, dachte ich, probiere ich‘s mal so. Ich hab gehofft, wieder jemanden zu finden für länger. Es ist jetzt zwar peinlich, das zuzugeben, aber ja, einfach die Sehnsucht nach Liebe.“ (S. 12)
Der Koch nickt wissend. Ganz ähnlich die erste Szene bei den Frauen: Janina schlichtet Putzmittel und Klopapier auf ihren Wagen und murmelt dabei, als würde sie sich bei uns vorstellen: sie spricht zu sich selbst und gleichzeitig in die Kamera:
„I am a world traveller. I travelled around all my life. I was always on my way, somewhere. So for me relationship is not so … does not interest me. Does interest me but also does not interest me. I just need lovers. And like this – you can have a lover in every city.“ (S. 13)
Im Aufenthaltsraum, wo alte Leute in ihren Sesseln und Rollstühlen vor sich hin schlafen, meist im Nachthemd, das Anziehen lohnt sich nicht mehr, sitzt die etwas noblere Augustine, hochgesteckte Haare, Lippenstift. Agathe erklärt ihr, wie der altmodische Computer funktioniert:
„Es gibt diese Oberfläche, da musst du dich anmelden, mit deinem Namen oder einem erfundenen Namen. Kann aber dann hinterher halt stressig werden, wenn du einen falschen Namen angenommen hast, da musst du dann viel erklären. Na egal. Danach musst du ein Foto dazugeben. Das kann echt sein oder ein jüngeres von dir. Du beschreibst dich auch. Ich bin so und so … Meine Hobbys sind das und das … So Zeug halt. Dann kommen Antworten. Die schicken auch Fotos. Und dann kannst du die Kandidaten wegwischen oder annehmen.“ (S. 24)
Zwei andere alte Frauen lösen ein Kreuzworträtsel. Die eine hat einen Kuli in der Hand und ihre Lesebrille auf, die andere sabbert aus dem Mund und sieht zu. Dabei entsteht folgender Dialog:
„Kreuzworträtsellöserin: Es gibt Tinder und Grinder. Grinder ist halt für Gays. Und dann hat es noch so ein Derivat von Tinder gegeben, das nur damit geworben hat, dass es eben nicht so ist wie Tinder. Da musste man nicht wegwischen.
Zuseherin: Grinder war zuerst. Diese schnellen Sex-Plattformen waren ja eigentlich für die Schwulenszene gemacht. Jetzt ist das zu den Heteros gewandert. Aber ob das da so richtig ist? […] Die Heteros macht schneller Sex ja eher nervös und die Schwulen die wollen das. Wie Männer halt sind, müssen irgendwo reinspritzen. Am besten täglich.“ (S. 25)
Die Kreuzworträtsellöserin ist erstaunt. Dieses Wissen hätte sie ihrer sabbernden Kollegin gar nicht zugetraut.
Im überfüllten Zimmer von Ernst und Agathe, dem Ehepaar, zwischen dem Bücherregal und einem Korb mit Wolle, liest der intellektuelle Ernst in einem Werk von Kant, während Agathe strickt. Sie sieht sich bedächtig die vielen Bücher an – ob das jemals ihr Leben war? Rund um sie Fotos von ihr mit Ernst, als sie jung waren und auch als sie älter wurden. Ernst beginnt vorzulesen:
„Also ganz hetero-normativ, patriarchal muss man als Mann den ersten Schritt machen. Ich habe in einem von 20 oder einem von 25 Fällen erlebt, dass eine Frau mich zuerst anschreibt. Ernst liest begeistert weiter: Also man muss selber die Initiative ergreifen und dann muss man sich natürlich erst mal überlegen, was schreibe ich. Man darf dann nicht zu needy rüberkommen, aber man darf auch nicht … Ein einfaches »Hey, wie geht‘s«, das reicht halt nicht normalerweise.
Er schaut wieder nach, ob Agathe noch zuhört. Leider strickt sie wieder. Trotzdem liest Ernst weiter, schon weniger begeistert:
Dann muss man sich halt irgendwie eine nette Line einfallen lassen, ein bisschen jovialer, enthusiastisch, aber nicht zu enthusiastisch und gleichzeitig noch interessiert, und im besten Fall noch auf das Profilbild eingehen vielleicht, irgendwie, wenn sie was zu Hobbys oder sonst was geschrieben hat. (S. 30)
Agathe ist höchst beschäftigt mit ihrem Strickzeug und hört gar nicht mehr zu.
Eine andere Szene spielt im Waschraum, zahlreiche Wassertropfen verbreiten eine „stimmungsvolle Trauer, die irgendwie mit dem Ablaufdatum des Lebens und dem Lauf der Dinge zu tun hat“ (S. 35). Klaus und Konrad, herabhängende Haut, viel Würde, wie im Hamam. Licht dringt durch das Fenster. Klaus wird langsam von Johann in die Badewanne gehoben. Das Radio spielt eine Melodie.
„Klaus: Ich sah mir die Nachricht an. Ging auf ihr Profil. Und bingo. Ihr Nickname war »melody«. […] Unter ihrer Lieblingsmusik fand ich dieses außergewöhnliche Wort, das mich auf einmal mehr als neugierig machte. Sie höre wohl gerne »Indianermusik«. […]
Klaus duckt sich, der Rücken wird ihm gewaschen. […]
Und wir fingen an, unsere tiefsten Gedanken, Gefühle und Emotionen auszutauschen. Voll Poesie, Träumereien. Lachen, Weinen, Humor … all das, was uns bewegt. Wir schickten uns die Songs, die uns bewegen. Unser Leben war von Musik erfüllt. Wir erzählten uns gegenseitig von unserem harten Leben. (S. 36f.)
Der Dating-Alltag mit seinen vielfältigen Themen – neben Sex geht es um Sehnsucht, Verliebtheit, lebensrettende Freundschaften und sogar Liebe auf der einen, um Illusionen, Täuschungen und Computersucht auf der anderen Seite – zeigt ein buntes Panorama heutiger Glückssuche und lässt die jungen Menschen oft ebenso einsam zurück wie die Alten im Heim, die ihre verstorbenen Partner:innen und Familien schmerzlich vermissen.
Anja Salomonowitz ist als Filmemacherin bekannt für ihre unverwechselbare Ästhetik, die sich durch eine kunstvolle Verwendung von Farben und ein kreatives Zusammenspiel von Bild und Ton auszeichnet: „Die Filme, die ich mache, versuchen nicht, naturalistisch zu sein oder die Wirklichkeit nachzuahmen. Sie haben ihre eigene.“, schreibt sie auf ihrer Webseite. Auch das vorliegende Drehbuch bezieht seine Wirkung in erster Linie aus der Eigenwilligkeit des Arrangements. Bild und Ton stammen aus zweierlei Welten, die nicht unterschiedlicher sein könnten, aber im Zusammenschnitt umso intensiver aufeinander wirken. In diesem Schwebezustand zwischen Realität und Fiktion entsteht ein spielerischer und zugleich tiefgründiger Dialog über mehrere Generationen hinweg.
„Dieses Buch ist ein Drehbuch“, steht ganz klar in den Credits, auch die Vorbemerkung weist auf einen Film hin. Schade, dass die Online-Werbung des Czernin Verlags die Textsorte verschleiert und die Leser:innen auf „eine vielstimmige und sinnliche Erzählung über die Suche nach Liebe und Anerkennung im Zeitalter von Social Media“ einstimmt, denn ein Drehbuch ist nun einmal kein literarisch verdichteter Text: Die Szenenbeschreibungen und Interviews sind skizzenhaft, sprachlich eher schlicht, Fehler wurden (bewusst?) stehengelassen. Trotzdem entwickeln die Bilder, die beim Lesen entstehen, jede Menge Poesie und man beginnt unwillkürlich, im Kopf seinen eigenen, ganz persönlichen Film zu drehen.
Das ist ein spannendes Experiment – noch spannender wäre es allerdings, die künstlerische Umsetzung von Anja Salomonowitz zu sehen, die zuletzt mit ihrem beeindruckenden Porträt der Malerin Maria Lassnig – Mit einem Tiger schlafen – große Aufmerksamkeit erregt und zugleich eine Diskussion über künstlerische Freiheit versus Authentizität entfacht hat. Ihre aktuellen Projekte sind ein Film über die ukrainische FEMEN-Aktivistin Inna Shevchenko sowie das Drehbuch zu einem Kinofilm über Paula Modersohn Becker.
Sabine Schuster, Studium der Germanistik und Publizistik an der Universität Wien, Abschluss 1992, von 2001 bis 2023 Redakteurin des Online-Buchmagazins im Literaturhaus Wien.