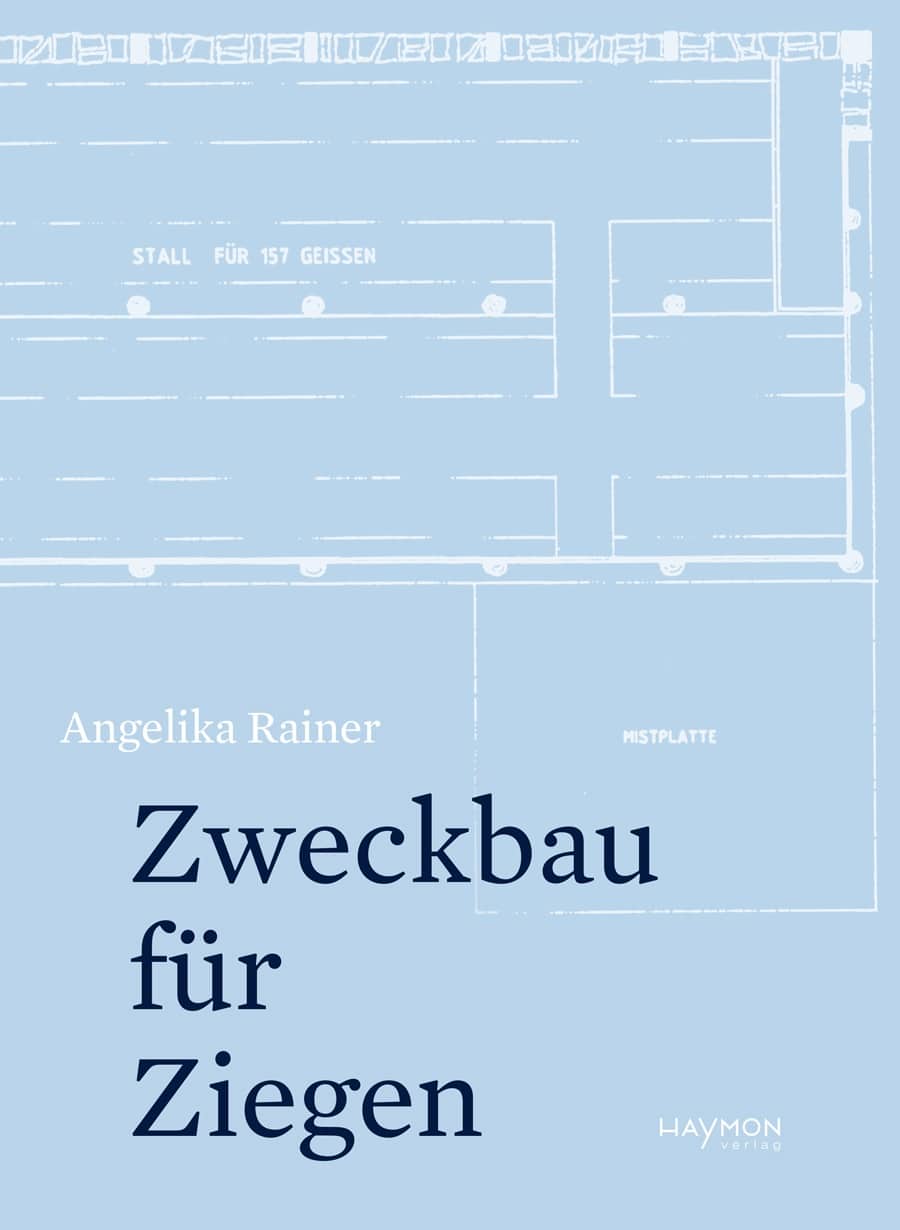Das Nachdenken über das Zuhause verweist auf ein hochaktuelles Thema, nämlich die ambivalente Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur. Zum einen benötigt der Mensch einen sicheren Raum, um sich vor den Gefahren zu schützen, die draußen auf ihn lauern. Zum anderen verstaut und behütet er in seinem Haus die ess- oder sonstwie verwertbaren Schätze, die er aus dem Wald oder Feld geborgen hat. Doch nicht nur in praktischer Hinsicht macht er sich die Natur zunutze: Angelika Rainer entlarvt auch die Neigung des Menschen, in seiner Umgebung stets etwas Metaphysisches zu sehen. Muss er immer etwas Menschliches in eine Landschaft hineindenken, sie sich philosophisch aneignen und zwangsläufig auf irgendeine Art verarbeiten?
Eines der zentralen Themen von Zweckbau für Ziegen ist die Vergänglichkeit. Schafft sich der Mensch ein Zuhause, um der Angst vor dem Tod zu entkommen? Rainer beschreibt Figuren, die diesem Unbehagen auf unterschiedliche, manchmal skurrile, Art begegnen: etwa einen Mann, der das Modell eines menschlichen Skeletts in seiner Wohnung aufgestellt hat, um sich täglich mit dem unausweichlichen Schicksal zu konfrontieren (S. 42). Eine andere menschliche Bewältigungsstrategie besteht darin, Erinnerungen zu schaffen. Immer wieder rekurriert Rainer auf das Sammeln, Ordnen und Aufbewahren von materiellen und immateriellen Schätzen – etwa dem langen Haarzopf der Mutter, der in einer Schachtel im Schrank liegt und dort verstaubt (S. 69). Besorgt fragt sich das lyrische Ich an einer anderen Stelle, was aus einem Menschen werde, „dessen Erlebnisse nicht mehr erzählt werden / nur als Notizen in Manteltaschen lagern“ (S. 46).
Eng verbunden mit der Vergänglichkeit sind Existenzängste. In einem der berührendsten Gedichte des Bandes ist das lyrische Ich an einem verschneiten Tag in der Stadt unterwegs und wird auf einen Maroniverkäufer aufmerksam. Die Überlegungen und Vermutungen zur Lebensweise dieses Mannes führen schließlich wieder zurück zur Natur, nämlich zum völlig überraschenden Vergleich mit einer Blume:
Wie die angeführten Beispiele bereits nahelegen, sind Rainers Gedichte durchwegs erzählerisch, häufig haben sie anekdotischen, dann wieder märchenhaften Charakter. Dennoch wird auch der rhythmische Aspekt nicht vernachlässigt, im Gegenteil: An keiner Stelle gibt es ein Wort zu viel, das den Lesefluss stören könnte – und dies obwohl die einzelnen Gedichte vergleichsweise lang, mitunter balladesk sind. Angesichts dieser melodischen Souveränität überrascht es nicht, dass Angelika Rainer auch als Musikerin tätig ist; in dem Tiroler Ensemble Franui spielt sie Harfe und Zither und singt. Ebenso wie die beiden Instrumente, die Rainer professionell spielt, sind auch ihre Gedichte leise und einladend und verlangen vom Publikum ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration. Handelte es sich bei diesem Band um eine Musik-CD, wäre der Begriff Konzeptalbum treffend: Zwar kann jedes der darin versammelten Gedichte für sich selbst stehen, jedoch ergibt sich aus dem Themenkomplex „Zuhause und Angst“ ein stimmiger roter Faden.
Der Titel Zweckbau für Ziegen mag als Andeutung verstanden werden, dass die Überlegungen über den Sinn eines Zuhauses nicht nur den Menschen betreffen, sondern auch die sogenannten „Haustiere“. Vielleicht passen sich jene Tiere, die eng mit uns zusammenleben, in ihren Ängsten an uns an? Durchgehend gelingt es Angelika Rainer, ästhetisch ansprechende Texte mit philosophischem Tiefgang zu verbinden und dem Lesepublikum en passant eine Fülle an Denkanstößen zu liefern. Darin liegt die große Stärke dieser Gedichte.
Daniela Chana, geb. 1985 in Wien, promovierte an der Universität Wien im Fach Vergleichende Literaturwissenschaft. Ihr Gedichtband Sagt die Dame (Limbus Verlag), wurde 2019 unter die Lyrik-Empfehlungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gewählt. 2021 folgte, wieder bei Limbus, der Erzählband Neun seltsame Frauen, der Chana eine Nominierung auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises eintrug. Für die Tageszeitung Die Presse schreibt sie regelmäßig Essays über Themen des Alltags und der Literatur.