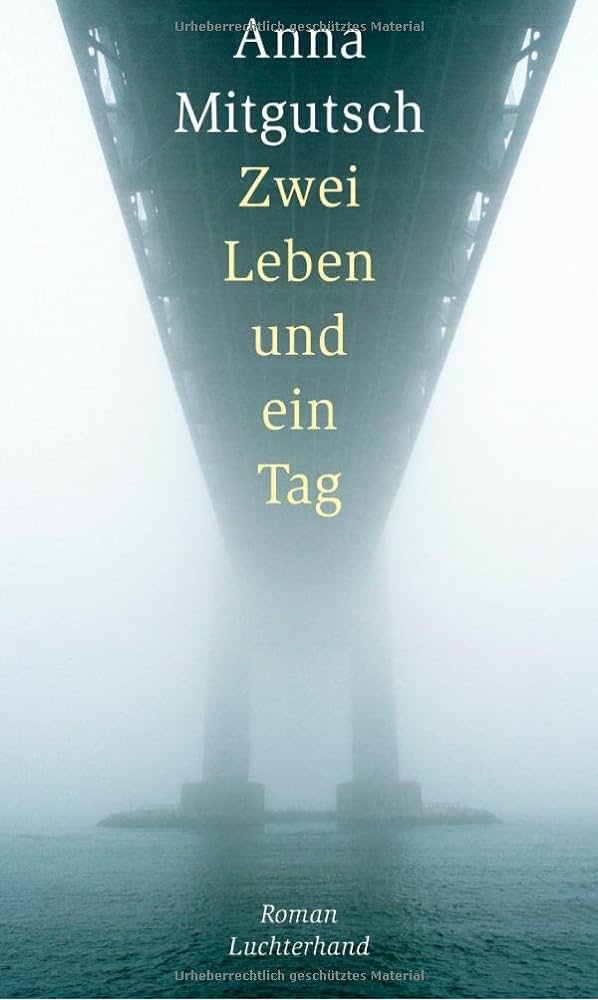Der amerikanische Romancier (1819-1891), der grandios Schiffbruch erlitt als Autor wie als Mensch, war jahrelang der Lieblingsautor der beiden Literaturwissenschaftler, die lange im Ausland lebten, bevor sie sich trennten. Bevor Edith in ihre österreichische Heimatstadt zurückkehrte und Leonard in Ungarn eine schon nach kurzem scheiternde Ehe mit einer viel jüngeren Frau einging. Sie hegten lange die Idee, gemeinsam seine Biographie zu verfassen. Doch schon rasch stellte sich heraus, dass sich beider akademische Karrieren nie realisieren würden. Leonard hatte nie den Rückhalt seines Professors, eines von ihm verehrten Melville-Forschers, dem er großes Vertrauen entgegengebracht hatte; und so zogen sie erst nach Südkorea, wo sie sich grundlegend fremd fühlten, später nach Malaysia, schließlich nach Budapest. An allen Orten bewies Leonard als Bibliotheksdirektor und -organisator wenig Fortüne. Genau so wenig wie in der Beziehung zu Edith.
Während Edith, in ihrer Heimatstadt sich lange mit Jobs über Wasser haltend, für die sie überqualifiziert war, über ihren Briefen sitzt, erhält sie die niederschmetternde Diagnose einer tödlichen Krebserkrankung. Ihre nie abgeschickten Episteln sind ihr letzter, ihr einziger Außenkontakt, zugleich das Resümee einer Verheerung, genannt Leben. Denn sie und Leonard sind multiple Untergeher, sind in jeder Hinsicht gescheitert. Als Intellektuelle, als Liebespaar, als Ehepaar, als Eltern. Hoffnung ist hier nirgendwo.
Und auch ihr Sohn scheitert mit seinem Aufbruch (das ist der „Tag“ im Titel). Er, der kurz zuvor seine Tätigkeit als Laufbursche in einer Druckerei verlor, verlässt zwei Jahre nach dem Tod seiner Mutter eines Morgens das Haus, aus dem er, dem Widerstand als Überlebensprinzip fremd ist, von einem Kurzzeitliebhaber seiner Mutter verdrängt wird, der sich darin immer platz- und raumgreifender breit macht. Er irrt durch die Stadt, den Koffer mit seiner einzigen Barschaft umklammernd, versucht noch, ein Mädchen, das er als Wesensverwandte glaubt erkannt zu haben, zur gemeinsamen Reise zum Vater, der in die USA zurückgekehrt ist, zu überreden. Er lässt sich mit ihr in eine Discothek locken, wo er schließlich erschlagen und sie vergewaltigt wird. Das Schlussbild ist von sprachlos machender klirrender Kälte. Die finale Katastrophe ist allumfassend, die Tragödie wird von Mitgutsch mit enormer, mit enorm niederschmetternder Unerbittlichkeit präsentiert. „Die Welt war leer. Gabriel lag mit dem Gesicht nach unten in einer Regenpfütze im Erlengestrüpp jenseits der Uferstraße, und Lydias geschändeter Körper war wie gekreuzigt auf die Böschung hingestreckt.“
Die Linzer Schriftstellerin greift auch in ihrem neuen Roman auf aus ihrem Werk bekannte Motive wie Ausgrenzung, Verlust, Niederlage, Trauer zurück. Schon in ihrem Roman „Ausgrenzung“ gab es etwa die Konstellation einer Mutter mit autistischem Sohn. Den besonderen Reiz dieses Buches, seine Literarizität, auch seine Sprachmacht, macht aber die Spiegelung aus, die Parallelisierung mit der Biographie Melvilles, des einst so viel versprechend gestarteten Autors, der mit jedem neuen Buch auf immer heftigere Ablehnung, schließlich nur noch auf eisiges Schweigen stieß. Entlang seiner nacherzählten Biographie entfaltet sich ein Panorama des unerbittlichen Niedergangs eines Schwierigen, eines lebenslang Unverstandenen, dessen Genie von den Zeitgenossen, vor allem von seiner Familie nie auch nur im Ansatz erkannt, geschweige denn gewürdigt wurde. Im Gegenteil: Die überzeugendsten Passagen schildern die existenzielle und psychische Verhärtung des mit 50 Jahren den ungeliebten Brotberuf als Hafeninspektor aufnehmenden Künstlers, die grandiose Isolation. Und die immer neuerlichen Anläufe, große Kunst zu schaffen. Gegen den Widerstand der Umwelt. Gegen den Hohn der Kritik.
Dies schildert Anna Mitgutsch in einer eindrucksvollen Prosa, in der sie stellenweise so elegant, so bildstark und so eindringlich schreibt wie selten zuvor.