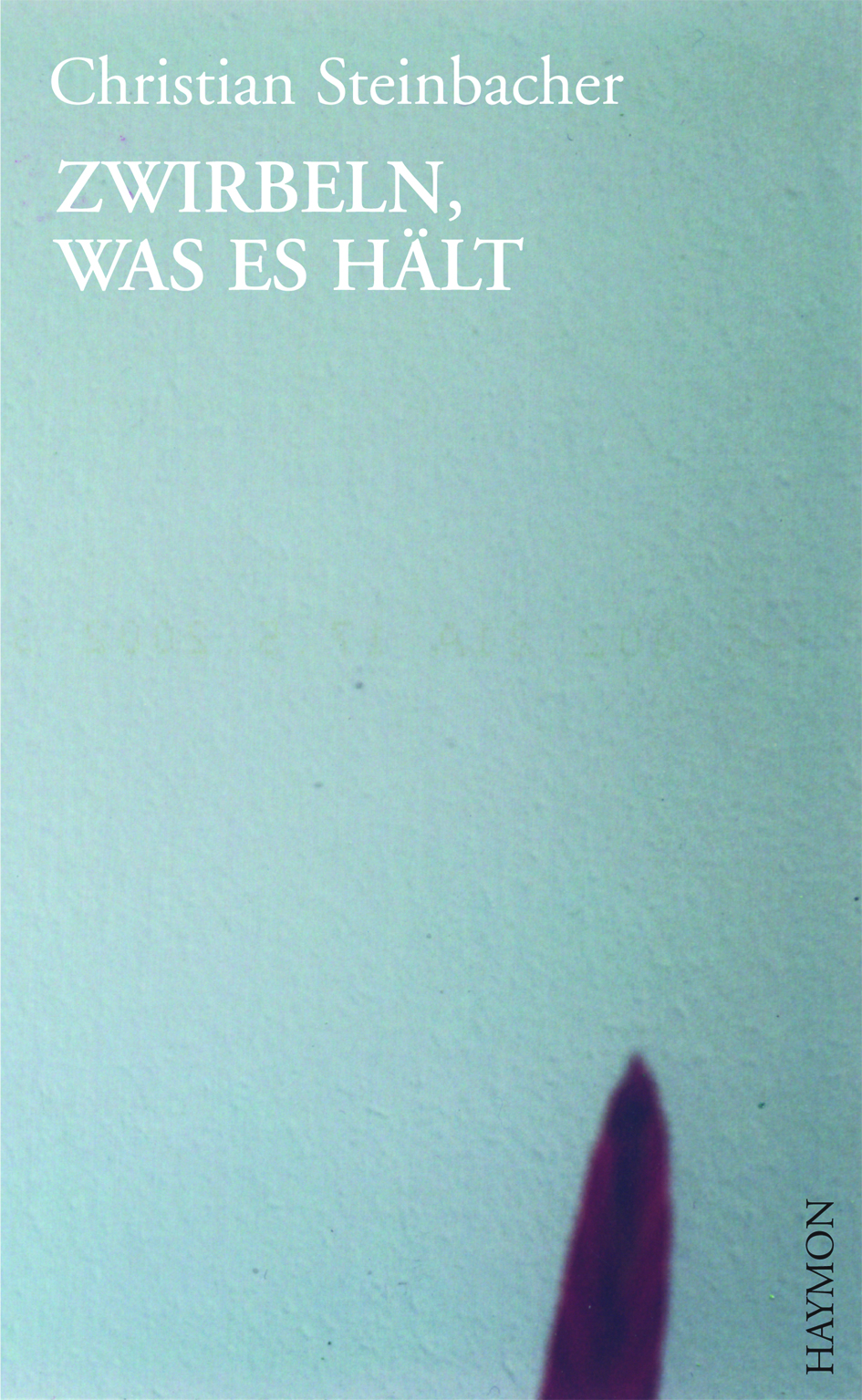In dem Band Zwirbeln, was es hält bündelt Steinbacher sechs Jahre nach der wandel motzt wieder die Lyrikproduktion mehrerer Jahre. Und wie in dem 2004 erschienenen großen Prosabuch Die Treffsicherheit des Lamas fällt auch hier wieder auf, daß die Texte des virtuosen Sprachartisten mehr und mehr mit unserer alltäglichen sprachlichen Umgebung Fühlung aufnehmen und dabei auch die Niederungen des Fernsehens und des Konsums nicht meiden, daß ihr Verschmutzungsgrad steigt. Während ältliche Jungautoren heute wieder biedermeierlicher Naturlyrik zu bedenklicher Blüte verhelfen und auch viele Altvordere des Experiments Schutz beim Wahren Guten Schönen suchen, stellt sich Steinbacher mit dem Rüstzeug seiner hochreflektierten Poetik und geschult an experimenteller, konzeptueller und phonetischer Poesie dem sprachlichen Weltzustand. Und das ist nicht nur spannend und mutig, sondern auch ausgesprochen erfrischend. Denn Steinbacher zeigt, daß es eine hochartifizielle Lyrik geben kann, die auch in einem ernstzunehmenden Sinne zeitgenössisch ist und sich in keinem Elfenbeinturm versteckt.
Bereits ein Blick ins Inhaltsverzeichnis macht deutlich, wie weit gespannt die sprachlichen Felder sind, die Christian Steinbacher „auf spielerische Art, mit Kniffen“ durchstreift. Man findet dort Titel wie „Auf ein Zahnrad“, „In der Kunststopferei“, „Marmaramatros‘ nippt ILLY“ oder „Fresienseptett“. „Gemäß Vertracktheitsfreuden“ und also wie von Steinbacher gewohnt sind die lyrischen Gebilde auch in diesem neuen Band ausgefuchst artifiziell, fein geschliffen, rhythmisch ausgeklügelt. Buchstäblich von Zeile zu Zeile, von Wort zu Wort stellen Überraschungen sich ein, wird der Leser mit unerwarteten Assoziationen und Assonanzen konfrontiert. Steinbacher bürstet sein Material gegen den Strich und schlägt aus ihm Funken. In einem Gedicht mit dem rätselhaften Titel „Das grosse Kikeriki oder schwedisches Heimweh“ wird dann etwa innerhalb eines Verses folgender sprachlicher Weg zurückgelegt: „Ob Wind auch an der Spree weh, was uns frisch zerzaus/im Vorfeld dieser aufgespannten Windschutzschneise,/ob dort ein Stadtteil auch Klein-Mexiko mit Namen,/wo es die kleinen Hunde durch die Lüfte wirbelt,/weiß wohl der Gockel nur, der mir da nimmt die Ruh.“ So wirbelt Steinbacher durch die Gedichtzeilen, in denen er sich aber auch immer wieder mit poetologischen Fragen auseinandersetzt, sich etwa skeptisch fragt: „Wenn’s aber nirgends hinführ?“ Er gibt sich aber dann sogleich die Antwort: „Auf spielerische Art, mit Kniffen, einzuseifen/solch Grenzwert reicht uns doch bereits.“
Bildet das eingangs erwähnte, ins Offene ausgreifende Langgedicht den einen Pol der Steinbacher’schen Lyrik, so wird der andere von den „Kolleginnenakronymen“ gebildet, die sich an den Buchstabenfolgen von Namen wie Birgit Schwaner, Elfriede Czurda, Elisabeth Wandeler-Deck oder Lisa Spalt abarbeiten. Hier begegnen wir einerseits dem konzeptuell, mit strengem Kalkül arbeitenden Steinbacher einer früheren Phase, der in diesen Akronymen aber derart disparates Material verarbeitet, daß diese Texte auch eindeutig Arbeiten jenes Steinbacher sind, der es unverfroren mit unserer sprachlichen Umwelt aufnimmt.